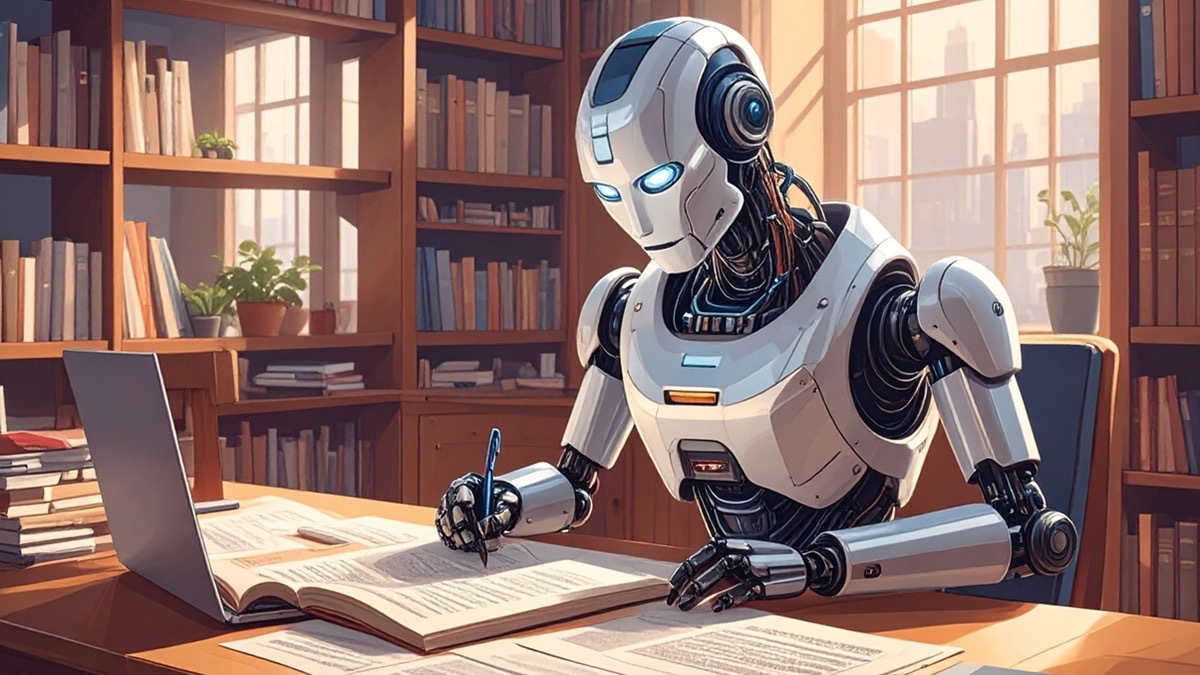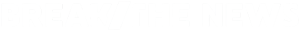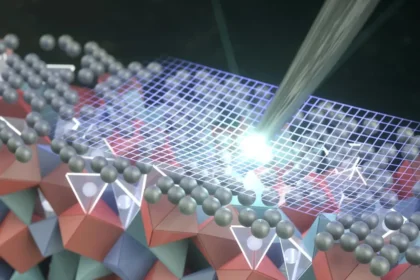Digitale Moderatoren, virtuelle Podcast-Hosts und automatische Übersetzungen: KI im Journalismus nimmt eine immer größere Rolle ein. Die unterschwellige Gefahr: Was passiert, wenn unsere Medien durch KI-Halluzinationen und vorgefertigte politische Einschläge manipuliert werden?
Hintergrund
- Sowohl Medienmacher als auch Konsumenten unterstützen den Einsatz von KI im Journalismus – Tendenz seit Jahren steigend. Eine Studie der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten glaubt, dass die Auffindbarkeit und die Recherchequalität durch Künstliche Intelligenz verbessert. Wichtigste Voraussetzung: strenge Kontrolle.
- Für Verlage und Medienhäuser ist es essenziell, sich ausführlich mit KI zu beschäftigten. Der Grund: Das eigene Geschäftsmodell ist durch KI stark gefährdet. Ein prominentes Beispiel gefällig? Microsoft hat ein Text-to-Speech-Modell mit dem Namen „VibeVoice“ veröffentlicht, das problemlos mehrstimmige Podcasts mit bis zu 90 Minuten Länge erstellen kann. Logischerweise stellt sich die Frage: Braucht es bald noch Podcaster und Radiomoderatoren?
- Ein Vorreiter in der deutschen Medienlandschaft ist der Axel-Springer-Konzern. Mit der „KI-Welt“ hat der TV-Sender Welt eine Sendung gestartet, bei der KI von der Themensuche, über das Texten bis hin zum virtuellen Moderator große Teile der Arbeit übernimmt. Die letzte Entscheidung liegt jedoch noch bei Reporter Paul Klinzing.
Einordnung
In kaum einer Branche ist der wirtschaftliche Druck so groß wie in der Medienbranche. Rückläufige Auflagen, sinkende Werbeumsätze, wachsende Konkurrenz durch digitale Content Creator und steigende Personalkosten setzen Verlagen seit Jahren zu. Nicht ohne Grund ist häufig die Rede von einem Haifischbecken für Berufseinsteiger.
Für findige Geschäftsführer ist die KI im Journalismus daher ein gefundener Heilsbringer. Ein paar Stichpunkte und eine gut trainierte KI genügen und die Sportberichte aus der Kreisliga, der Wetterbericht und die Zusammenfassung der Stadtratssitzung sind in wenigen Minuten verfasst. Einmal noch inhaltlich Korrekturlesen – und fertig. Dafür braucht es keine vier Vollzeitredakteure, ein Teilzeitlektor mit 20 Stunden reicht vollkommen.
Je weniger Menschen an Medienprodukten mitarbeiten, desto wichtiger wird es, dass es für den Einsatz von KI im Journalismus klare Regeln gibt. Das beginnt damit, dass alle mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellten Inhalte eine klare Kennzeichnung brauchen.
Stimmen
- Jan Philipp Burgard ist Chefredakteur der WELT-Gruppe bei Axel Springer. Er sagt: „Wir werden die KI-Revolution nicht aufhalten können, deswegen sollten wir sie umarmen und mitgestalten. Unsere neue Sendung KI-WELT ist ein Experiment, um zu zeigen, was bereits möglich ist. Die regulären Nachrichtensendungen werden selbstverständlich weiter von echten Menschen moderiert.“
- Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, sieht Journalisten in der Pflicht: „Finale Entscheidungen müssen am Ende immer das Ergebnis menschlicher Überlegungen sein, nicht das Produkt einer noch so intelligenten Maschine. Auch für viele der von uns befragten Nutzerinnen und Nutzer ist das eine zentrale Voraussetzung für den Einsatz von KI im Journalismus.“
- Sascha Devigne, Chefredakteur beim lokalen Fernsehsender Studio 47, rückt die wirtschaftlichen Vorzüge in den Vordergrund: „Hinsichtlich knapper finanzieller Mittel und steigendem Mangel an Fachkräften ist der Einsatz künstlicher Intelligenz für uns eine wichtige Entlastung. Dank unserer selbstentwickelten KI-Tools konnten wir sogar den Programmumfang steigern, sind inhaltlich dichter und journalistisch relevanter geworden und haben die Sendezeit unserer Primetime-Formate um 50 Prozent verlängern können.“
Ausblick
Einen Journalismus ohne Künstliche Intelligenz werden wir nicht mehr erleben. Wer daran glaubt, lebt in einer Fantasiewelt. Deshalb ist es von größter Bedeutung, dass wir ein Maximum an Transparenz schaffen. Denn schon jetzt können Konsumenten nicht zuverlässig unterscheiden, welche Inhalte und Moderatoren (!) menschlich oder künstlich sind.
Mit dem weiteren Fortschritt werden die seh-, hör- und lesbaren Unterschiede zwischen Menschen und Künstlichen Intelligenzen noch geringer werden. Weil wir Menschen von Grund auf weniger nachdenken als wir uns eingestehen wollen, brauchen wir eine proaktive Aufklärung und Hinweise, damit wir nicht unterbewusst gelenkt werden. Jeder Mensch muss erkennen können, was von KI gemacht worden ist.
Denn: Sowohl die Voreingenommenheit von KI als auch die Tendenz zum wilden Flunkern, wenn einmal die passenden Daten fehlen, sind in Kombination mit hoher Reichweite gefährlich.
Auch interessant: