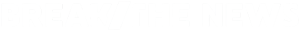Der deutsche Softwarekonzern SAP hat eine Kooperation mit ChatGPT-Entwickler OpenAI angekündigt. Ziel ist es, KI-Technologien in deutschen Behörden, Verwaltungen und Forschungseinrichtungen zu etablieren. Die Initiative „OpenAI für Deutschland“ soll 2026 offiziell starten.
Hintergrund: KI-Plattform für Behörden
- Unter dem Namen „OpenAI für Deutschland“ soll eine Plattform entstehen, die speziell auf den öffentlichen Sektor zugeschnitten ist. Damit europäische Standards greifen können und die Datenhoheit in Deutschland bleibt, soll sie von SAP-Tochter Delos Cloud, die die Azure-Technologie von Microsoft nutzt, angeboten werden.
- SAP will seine Cloud-Infrastruktur bei Tochtergesellschaft Delos auf 4.000 Hochleistungs-Grafikprozessoren für KI-Anwendungen in Deutschland ausbauen. Mit dieser Kapazität würde man zur nationalen Spitze gehören. Führende KI- und Cloud-Nationen wie China oder die USA, aber auch Schwellenländer wie Indien, verfügen jedoch über noch mehr Rechenpower.
- „OpenAI für Deutschland“ soll es Millionen Beschäftigten im öffentlichen Sektor ermöglichen, KI sicher und verantwortungsvoll nutzen zu können sowie Datenschutz und rechtliche Vorgaben einzuhalten. Ziel ist es, ihre tägliche Arbeit zu beschleunigen und mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben statt für administrative Tätigkeiten freizuräumen.
Einordnung: „OpenAI für Deutschland“
„OpenAI für Deutschland“ könnte ein echter Befreiungsschlag im Kampf gegen Stempel, Aktenordner und Faxgeräte sein. Mit Rechenpower und KI-Technologie allein wird man das Problem aber nicht lösen können. Denn neben mangelnder Digitalisierung gilt es auch, die verkrusteten Strukturen im deutschen Verwaltungsrat aufzubrechen.
Die Versprechen von digitaler Souveränität und deutscher Datenhoheit klingen zwar verlockend. Doch fast zeitgleich mit der angekündigten Kooperation hat die EU ein Wettbewerbsverfahren gegen SAP eingeleitet. Der Vorwurf: Das Unternehmen soll sich unerlaubte Vorteile gegenüber der Konkurrenz geschaffen haben.
SAP-Partner Microsoft hatte zuvor ebenfalls mit einer europäischen Lösung für seine Cloud-Dienste geworben. In einer Anhörung musste der Windows-Konzern jedoch eingestehen, dass man nicht zu 100 Prozent garantieren könne, dass die Daten europäischer Bürger auch in Europa bleiben.
Das Potenzial, die öffentliche Verwaltung in Deutschland zu modernisieren, hat KI jedoch allemal. Mehr noch: Sie ist gewissermaßen wie dafür geschaffen, administrative Aufgaben zu übernehmen. Das könnte nicht nur Bürokratie abbauen, sondern auch Kosten sparen.
Stimmen
- OpenAI-Chef Sam Altman lobt: „Deutschland ist seit Langem führend in Ingenieurwesen und Technologie. Mit OpenAI für Deutschland werden wir gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial auf den öffentlichen Sektor auszuweiten – um Dienstleistungen zu verbessern und sicherzustellen, dass die Vorteile von KI im ganzen Land ankommen, und zwar im Einklang mit Vertrauen und Sicherheit.“
- Christian Klein, CEO der SAP SE, ergänzt: „Als Business-KI-Unternehmen sind wir überzeugt, dass OpenAI für Deutschland einen großen Schritt nach vorn darstellt. Wir bündeln das Know-how von SAP mit der führenden KI-Technologie von OpenAI und ebnen so den Weg für KI-Lösungen, die in Deutschland für Deutschland entwickelt werden.“
- Der AI Act der EU könnte dem Vorhaben jedoch im Wege stehen. Digitalexperte Sascha Lobo kritisiert die KI-Verordnung in seiner Spiegel-Kolumne etwa als „bürokratieextremistische Fehl- und Überregulierung“: „Wer auch immer KI unternehmerisch verwendet, muss im Zweifel unfassbar viel dokumentieren, managen, nachweisen und einschätzen. Auch Dinge, die man gar nicht wissen kann.“
Ausblick: Gelingt der Bürokratieabbau mit KI?
Für die Bundesregierung könnte „OpenAI für Deutschland“ genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Denn das Merz-Kabinett hat nicht nur einen Bürokratieabbau, sondern auch Kosteneinsparungen im Verwaltungsapparat versprochen.
Doch dafür muss man auch an die fast schon mittelalterlichen Grundstrukturen in der öffentlichen Verwaltung ran. Der AI Act der EU könnte zudem zu einem Bremsklotz werden. Denn die KI-Verordnung sieht für den Einsatz von KI in Unternehmen und Behörden zahlreiche Dokumentationspflichten und Nachweise vor.
Als Schutzschild gegen Missbrauch gedacht, könnte der AI Act zu einem neuen Handbuch der Bürokratie-Hydra werden. KI könnte dann zwar Bürokratie abbauen, aber auch neue Vorgaben und Pflichten schaffen – zumal die Verordnung relativ schwammig formuliert ist.
Da der AI Act aber auch als laufender Prozess verstanden werden muss, den die EU-Länder selbst in nationales Recht umsetzen müssen, obliegt es letztlich der Bundesregierung, ob der Bürokratieabbau und die Digitalisierung im öffentlichen Sektor gelingen.
Auch interessant: