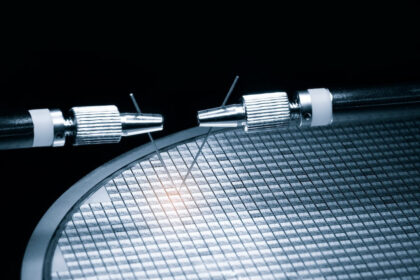Das Internet kann uns demokratischer machen. Die Piratenpartei hat uns dazu vor einigen Jahren einen entscheidenden Denkanstoß verpasst.
Die Überraschung war groß im Oktober 2011, als die noch junge Piratenpartei mit sagenhaften 8,9 Prozent in das Berliner Abgeordnetenhaus einzog. Es schien für einen Moment so, als könne sich ein neuer Mitspieler im Parteiensystem etablieren. Doch die Ernüchterung folgte unmittelbar, Kritik machte sich schnell breit. Man warf den Piraten vor, sie seien von der nun verliehenen parlamentarischen Verantwortung überfordert und sie hätten vor allem gar kein richtiges Programm. Denn der vielzitierte Satz Marina Weisbands, die Partei habe nicht bloß ein Parteiprogramm, sondern ein Betriebssystem, einen neuen Politikstil anzubieten, wurde kurzerhand in einen Mangel an politischen Überzeugungen und Inhalten umgedeutet.
Und nun, 5 Jahre später, ist die Piratenpartei in Berlin bei nicht einmal mehr 2 Prozent zurück auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Der mediale Hype scheint nun vollends vorbei. Und viel bleibt nicht übrig von den großen, neuen Ideen und Vorstellungen, die man oft und gerne äußerte. Doch dabei sollte eins nicht vergessen werden: Die Partei wusste damals überraschend präzise, demokratische Defizite auszumachen. So beklagten die Piraten – für eine neue Partei durchaus üblich – den zunehmenden Einfluss privater Akteure auf die Politik. Und schon seit längerem prangern Politologen an, die repräsentative Demokratie halte der Dynamik und Schnelligkeit unserer digitalen Gesellschaft kaum noch stand, sei viel zu schwerfällig.
Mit ihrer hierarchielosen, basisorientierten Organisationsstruktur, ihrer Forderung nach mehr Transparenz und Partizipation, trug die Piratenpartei sinnvolle, zeitgemäße Beiträge in die politische Parteienlandschaft hinein. Denn dieser neue Politikstil, das „Betriebssystem“, besser bekannt als Liquid Democracy, war eine demokratische Idee, eine Alternative, die es zwar schon gab, vorher aber so gut wie niemand kannte und durchaus neugierig machte.
Liquid Democracy: Was war das noch gleich?
Die Piraten versuchten da nichts geringeres, als unser Denken über Politik und Repräsentation zu revolutionieren. Ein viel zu großes Unterfangen natürlich für eine so kleine Partei. Doch interessant war dieser Einwurf allemal. Denn Liquid Democracy versucht, Politik und Internet viel enger zu verbinden. Das soll politische Prozesse einerseits transparenter, andererseits partizipativer machen.
Das Internet hat gewaltige gesellschaftliche Veränderungen bewirkt. Es ist ein freier und vor allem schneller Zugang zu Informationen jeder Art möglich. Vor allem wer mit dem Internet aufgewachsen ist, begreift es als dynamischen Raum ohne starre Strukturen. Gleichzeitig sinkt die Motivation, sich dem Programm einer Partei zu fügen. Politische Verantwortung können und wollen viele nun selbst übernehmen. Hier versucht Liquid Democracy anzuknüpfen. Es soll nämlich jeder bei politischen Abstimmungen direkt mitmachen dürfen. Und wer keine Zeit oder Lust hat, überträgt seine Stimme abhängig nach Thema auf jemanden, der davon Ahnung hat.
Ist das nicht genau das, was wir brauchen? Ist das nicht die Antwort auf Populisten von links und rechts, die seit Jahren mehr Bürgerbeteiligung fordern?
Piratenpartei, Internet und Demokratie
Nein. Liquid Democracy ist als Ersatz für die repräsentative Demokratie völlig ungeeignet. Demokratie, die vollständig im Internet stattfindet, kann (noch) nicht funktionieren. Und auch die Piraten selbst hatten mit so einigen innerparteilichen Problemen zu kämpfen, wenn sie unter sich Liquid Democracy mit der Software Liquid Feedack anwendeten.
Doch trotzdem können wir einiges vom vergangenen Hype um die Piratenpartei lernen: In Zeiten des digitalen Wandels muss sich auch die Politik wandeln und an die äußeren Umstände einer beschleunigten Kommunikation, einer ständigen Informiertheit der Bevölkerung anpassen. 2013 bezeichnete der Politologe Christoph Bieber die Partei als einen „Agent des Wandels“, weil sie mit ihrem Politikstil auf andere Parteien abfärbte. Doch davon ist nicht mehr viel übrig. Die demokratischen Potentiale des Internets werden seltener wahrgenommen. Im Gegenteil: Im Umgang mit Pegida, Hatespeech und Trollen entsteht schnell der Eindruck, das Internet entwickle gerade eine eher undemokratische Eigendynamik.
Macht uns das Internet demokratischer?
Dabei kann es zweifelsohne durch seine dezentralen und inklusiven Eigenschaften eine Demokratie besser, demokratischer machen. Internet und Demokratie können zusammenpassen, wenn man sie richtig verbindet. Beispielsweise müssten digitale Demokratiepotentiale durch Software außerhalb bekannter sozialer Medien viel besser genutzt werden. Eine digitale, demokratische Plattform etwa, die alle Teilnehmenden wie im Wahllokal gleich behandelt und nicht die lautesten Kommentare mit den meisten Likes oder Followern bevorzugt.
Soll das Internet uns demokratischer machen, müssen solche Entwürfe wie die der Piraten wieder breiter diskutiert werden. Die Mehrheit der Internetnutzer sieht zwischen Facebook, Katzenbildern und Modeblogs kaum Chancen der politischen Beteiligung. Doch die sind zweifelsohne vorhanden.
Einen Denkanstoß dafür lieferte die Piratenpartei.