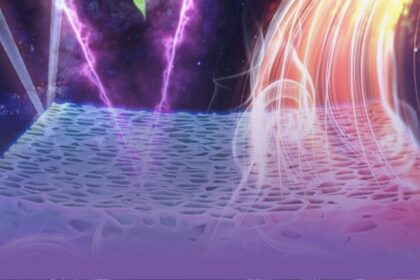Es hat lange gedauert, ist durch verschiedene Versionen gegangen: das Gesetz für Elektrokleinstfahrzeuge in Deutschland. Doch eins ist immer gleich geblieben: Scooter-Sharing war nie ein Thema. Jetzt müssen die Städte das ausbaden. Ein Kommentar.
Das neue Gesetz für Elektrokleinstfahrzeuge ist nach langem Hin und Her abgesegnet. Am Samstag war der offizielle Start. Und jetzt erst fängt man an, über Scooter-Sharing nachzudenken.
Für mich war das von Anfang an ein Rätsel. So oft der Entwurf zu den Elektrokleinstfahrzeugen – der vor allem E-Scooter betrifft – auch geändert wurde, eins blieb immer gleich: Scooter-Sharing war kein Thema.
Scooter-Sharing ignoriert: Das wird sich rächen
In einem der Entwurfstexte steht: „Wird davon ausgegangen, dass 80 Prozent der prognostizierten Fahrzeuge … privat genutzt werden, ergibt sich eine jährliche Fallzahl [von] 24.000 bis 120.000 Elektrokleinstfahrzeugen.“
Diese Zahl habe ich im aktuellen Gesetzestext nicht mehr gesehen. Doch nehmen wir einmal an, diese Zahl stimmt. Was ist mit den anderen 20 Prozent?
Mathematisch mag das nicht relevant klingen. Doch schau dir einmal an, wie andere Städte dieser Welt mit diesen 20 Prozent zu kämpfen haben. Das Hauptproblem beim Scooter-Sharing ist dabei nicht das Sharing an sich, sondern vielmehr das Free-Floating-Modell.
Dabei muss man die E-Roller nach Gebrauch nicht an eine bestimmte Station zurückbringen, wie beim stationsbasierten Modell. Stattdessen kann man die E-Scooter im Prinzip überall abstellen, wo man will.
Natürlich gibt es dabei in den meisten Städten definierte Zonen, in denen das erlaubt ist. Diese sind aber meist so großzügig ausgelegt, dass Scooter-Sharing in Städten auf der ganzen Welt für Chaos gesorgt hat.
In Honolulu gab es einen Rechtsstreit um die invasiven E-Scooter. San Francisco hatte die Elektroroller eine Zeit lang komplett aus der Stadt verbannt. Paris will das „wilde Parken“ jetzt verbieten.
Das Problem ist überall relativ ähnlich: Die Scooter landen meist achtlos irgendwo auf dem Bürgersteig. Zum einen sind sie damit gefühlt immer im Weg. Zum anderen sorgen hingeschmissene Scooter an jeder Ecke nicht gerade für ein schönes Stadtbild.
Hinzu kommt, dass man für ein stationsloses Modell immer mehr Fahrzeuge braucht als für die Sharing-Angebote mit festen Andock-Punkten.
Wenn ich Kunden zusichern will, dass sie jederzeit ein Fahrzeug in ihrer Nähe finden können, muss ich die entsprechende Masse an Fahrzeugen zur Verfügung stellen. Das heißt: Dieses Sharing-Modell erfordert sehr viel mehr E-Scooter als das stationsbasierte Modell.
Das Ergebnis ist die Scooter-Plage, die viele Städte erleben. In Paris zählt die Stadt aktuell zwölf Anbieter und 20.000 E-Scooter. Wenn die Regierung also mit maximal 120.000 Elektrokleinstfahrzeugen rechnet, scheint das hoffnungsvoll niedrig angesetzt.
Daher ist es natürlich sträflich, wenn der deutsche Gesetzgeber Scooter-Sharing komplett ignoriert … oder besonders clever. Weil sich damit der Bund erstmal zurücklehnen kann und die Städte nun das Ganze irgendwie richten müssen.
Städte können E-Scooter kaum regulieren
Wie das aussehen kann, sieht man jetzt am Beispiel Hamburg. Hier stehen schon ein halbes Dutzend Sharing-Anbieter in den Startlöchern, einige davon setzen auf das Free-Floating-Modell.
Um das Chaos anderer Städte zu vermeiden will Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann die Zahl der E-Scooter von Anfang an begrenzen. Allerdings kann er das nur vorschlagen und darauf hoffen, dass die Sharing-Anbieter sich freiwillig darauf einlassen. Warum, erklärte Westhagemann in einem Pressegespräch:
Es gibt keinerlei Rahmenbedingungen, die uns erlauben, vorab die Zahl der Roller zu limitieren. Regulativ eingreifen kann nur der Bund.
Die Stadt hat zwar die Möglichkeit, die Anzahl der Scooter sowie die Fahrzonen grob einzuschränken. Hamburg hat darüber hinaus einige Zonen vorgeschlagen, in denen die Scooter nicht abgestellt werden sollen.
Damit seien die Möglichkeiten der Stadt schon ausgeschöpft, sagt Westhagemann. Ob sich die Anbieter daran halten, hat die Stadt auch nicht in der Hand.
Zu viel Spielraum für Anbieter
Im Prinzip ist es ja keine schlechte Idee, die konkreten Regelungen beim Scooter-Sharing den Städten zu überlassen. Schließlich ist die Situation in jedem Ort anders.
Dennoch ist es ein wenig seltsam, dass die Städte nicht besonders viel Spielraum haben und auf den guten Willen der Anbieter angewiesen sind oder notfalls auf Regulierungen vom Bund hoffen müssen.
Wie das enden kann, hat man beim Obike-Desaster in München gesehen. Der Bikesharing-Anbieter Obike platzierte mal eben 8.000 Fahrräder in der Stadt. Durch verschiedene Qualitäts- und Betriebsprobleme lagen plötzlich tausend kapputte Räder überall herum, zum Teil sogar in Flüssen.
Natürlich muss Scooter-Sharing in deutschen Städten nicht im gleichen Chaos enden und grundsätzlich ist es auch eine gute Idee, der Transportmöglichkeit erstmal eine Chance zu geben und sie nicht von Anfang an tot zu regulieren.
Ich bin normalerweise die erste, die sagt: Lass es uns erstmal probieren! Doch in dem Fall muss ich sagen: Lass uns von den Erfahrungen anderer Städte lernen und nicht dieselben Fehler machen!
Dennoch habe ich meine Zweifel, dass man den Städten genug Spielraum gelassen hat, um das Angebot im Notfall sinnvoll kontrollieren zu können.
Kontrollieren heißt nicht verbieten
Kontrollieren muss in dem Fall ja nicht verbieten heißen. Ideal wäre es, Scooter-Sharing so einzubinden, dass es ein hilfreiches Transportangebot für Städter wird, Autos ersetzt und insgesamt den Verkehr schneller und angenehmer fließen lässt.
Darüber haben sich aber wenige Städte bislang wirklich ernsthafte Gedanken gemacht. Es gibt zwar Ideen den genauen Bedarf an E-Scootern und Abstellplätzen und Zonen durch ein Open-Data-System zu ermitteln.
Damit könnte man nicht nur ein Scooter-Gate vermeiden, sondern auch smarte Verkehrsplanung betreiben.
In Städten wie Portland konnte so zum Beispiel ermittelt werden, dass 38 Prozent der Bewohner vom Auto auf E-Roller umgestiegen sind.
All das wären spannende und wichtige Ansatzpunkte für eine wirklich nachhaltige Einbindung der Elektrokleinstfahrzeuge in den Stadtverkehr.
Wenn zum Beispiel mehr als zwei Drittel der Bewohner E-Roller fahren, könnte man ja theoretisch – als plakatives Beispiel – vielleicht mehr Radwege und weniger Parkhäuser bauen.
Allerdings haben deutsche Städte hier bislang kaum oder noch gar nicht gehandelt.
Anstatt diese neue Form der urbanen Mobilität also proaktiv anzugehen und sie in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken, wird man nun also erstmal testen und dann reagieren. Die Frage ist nur: Ist es dann zu spät?
Denn wenn die Testphase nicht gut läuft, wird der Frust groß sein und die Akzeptanz für die Fahrzeuge sinken. Dann haben Städte möglicherweise eine Chance verpasst, die E-Scooter in den städtischen Verkehr zu integrieren.
Bin ich zu pessimistisch?
Vielleicht bin ich zu pessimistisch. Vielleicht läuft alles besser als ich es mir ausmale. Und vielleicht werden Städte und Sharing-Anbieter in Deutschland auch gute Lösungen finden. Das würde ich mir wünschen.
Mir scheint es aber ein wenig naiv, den Anbietern gesetzlich so viel Spielraum zu lassen und ich finde es schade, dass viele Städte nicht schneller gehandelt haben.
Das Scooter-Chaos in deutschen Städten ist nicht auszuschließen und ausbaden müssten es dann die Kommunen selbst.
Ich hoffe, dass ich am Ende unrecht habe.
Zum Weiterlesen