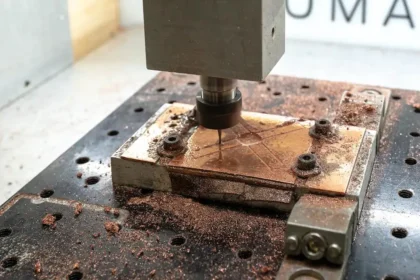Northvolt und Meyer Burger. Zwei Namen, die für eine grüne industrielle Zukunft in Europa standen. Nun stehen sie vor massiven finanziellen Probleme. Die eigentliche Gefahr lauert aber nicht nur in Schweden oder in der Schweiz, sondern vielmehr mitten in Deutschland.
Es klang wie der Traum eines jeden ambitionierten Politikers: Internationale Vorzeigeunternehmen kommen nach Deutschland, schaffen Jobs, investieren in „grüne“ Technologie und lassen sich, großzügig flankiert von millionenschweren Förderprogrammen, in strukturschwachen Regionen nieder.
Da war zum einen Northvolt, der schwedische Batterie-Gigant, der im schleswig-holsteinischen Heide eine mit millionenschwerer Förderung eine Gigafactory mit angekündigten 3.000 Arbeitsplätzen hochziehen wollte. Dann war da zum anderen Meyer Burger, ein traditionsreiches Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das Solarmodule in Sachsen-Anhalt produzieren wollte, ebenfalls mit Millionen gefördert.
Doch während in Deutschland stolz diese wirtschaftlichen Aktivitäten gefeiert wurden, wackelte andernorts das finanzielle und unternehmerische Fundament. Die Konzernzentralen der Muttergesellschaften sind nämlich unter Druck: Meyer Burger kündigte im Frühjahr 2024 an, sich aus dem US-Markt zurückziehen zu müssen – und warnte öffentlich vor einer möglichen Schließung der deutschen Werke.
Und Northvolt? Die Finanzierung des Milliardenprojekts Heide ist zumindest fragwürdig, denn die schwedische Muttergesellschaft hatte Ende 2024 in den USA die Durchführung eines Sanierungsverfahrens beantragt, was über eine US-amerikanische Tochtergesellschaft möglich wurde.
Das Verfahren scheiterte aber im April 2025. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die deutsche Gesellschaft hat verlauten lassen, dass der Bau der Fabrik nach Plan verlaufe. Nun könnte man sagen: Was interessieren mich die ausländischen Muttergesellschaften? Es geht doch um die Gesellschaften in Deutschland.
Und der Bau der Fabrik in Heide geht doch weiter, sagt zumindest die deutsche Northvolt-Gesellschaft. Dann ist doch alles „tutti paletti“…. Wer aber nur auf die deutschen Gesellschaften schaut, übersieht die gesellschaftsrechtlichen Strukturen dahinter. Und genau dort liegt das Problem.
Tochtergesellschaften: Eigenständig, aber nicht unabhängig
Zunächst zur Klarstellung: Wenn Unternehmen wie Northvolt oder Meyer Burger eine Tochtergesellschaft in Deutschland gründen, handelt es sich bei diesen rechtlich gesehen regelmäßig um eigenständige juristische Personen – in der Regel GmbHs, die typischerweise zu 100 Prozent der Muttergesellschaft gehören.
Diese Tochtergesellschaften haben ihre eigenen Geschäftsführer, ihre eigenen Konten, ihre eigenen Verträge. Sie können klagen und verklagt werden, sie können Gewinne machen – oder eben Verluste. Wenn also die Muttergesellschaft in Schweden oder der Schweiz in wirtschaftliche Schieflage gerät oder gar Insolvenz anmeldet, heißt das nicht automatisch, dass auch eine Tochtergesellschaft in Deutschland Insolvenz anmelden muss.
Aber – und aus diesem „Aber“ ergibt sich das Problem, insbesondere mit Blick auf die erfolgten Förderungen – wirtschaftlich hängt die deutsche Tochter oft am Tropf der Konzernmutter: strategisch, organisatorisch, finanziell. Die „Selbstständigkeit“ der Tochtergesellschaften ist formaljuristisch, aber selten faktisch. Denn:
- Investitionsentscheidungen trifft häufig die Eigentümerin, also die Muttergesellschaft.
- Kapital kommt oft aus dem Ausland, von der Muttergesellschaft als Gesellschafterin.
Die wesentlichen IP-Rechte wie Know-how, Patente, Markenrechte gehören typischerweise der Muttergesellschaft und werden über Nutzungsrechte der Tochtergesellschaft zur Verfügung gestellt. - Der Marktauftritt ist in der Regel konzernweit abgestimmt.
Wenn die Muttergesellschaft also finanziell angeschlagen ist und wankt – oder sogar in die Insolvenz gerät, gerät die Tochter unweigerlich auch finanziell in „schweres Fahrwasser“ – da sie hinsichtlich der Entscheidungen und der finanziellen Ausstattung an der Mutter hängt. Das gilt selbst dann, wenn das Tochterunternehmen auf dem Papier kerngesund ist.
Insolvenz der Muttergesellschaft: Auswirkungen auf die Tochtergesellschaft
Was passiert nun konkret, wenn die Muttergesellschaft insolvent wird? Zunächst übernimmt in der Regel ein Insolvenzverwalter die Kontrolle über die Muttergesellschaft. Dieser muss dann entscheiden, welche Vermögenswerte es noch gibt, was verkauft werden kann und welche Unternehmensteile eventuell überlebensfähig sind.
Die Tochtergesellschaften, die ja letztendlich als Beteiligungen Vermögenswerte darstellen, sind somit Objekte strategischer Entscheidungen. Manchmal bleiben sie als eigenständige Unternehmen bestehen und werden weitergeführt; es erfolgt dann eine Abtrennung von der Mutter. Manchmal werden sie verkauft. Manchmal werden sie schlicht liquidiert, weil kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr gesehen wird – oder weil schlicht das Geld fehlt, um die Unternehmen weiter zu betreiben.
Förderung ohne Plan
Warum ist es nun so wichtig, diese Hintergründe zu verstehen? Weil der deutsche Staat – also Bund, Länder, Kommunen – seit Jahren nicht unerhebliche Summen in solche wirtschaftlichen Projekte stecken, in der Hoffnung auf wirtschaftliche Ergebnisse, Entwicklung von Technologien, die als strategisch angesehen werden und natürlich auf die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Northvolt hat nach eigenen Angaben Förderungen im hohen dreistelligen Millionenbereich für die Gigafactory in Heide erhalten. Meyer Burger wurde in Sachsen-Anhalt mit rund 15 Millionen Euro an Investitionszuschüssen, neben dreistelligen Millionenbeträgen aus EU-Mitteln unterstützt, ergänzt durch weitere Infrastrukturmaßnahmen.
Und an dieser Stelle muss man es noch einmal betonen: Solche Förderungen sind von der Idee her sinnvoll, denn für wirtschaftliche Unternehmungen werden oftmals Geldmittel benötigt, die von Unternehmen nicht zur Verfügung gestellt werden können. Sie bringen aber etwa Know-how und Prozesse mit. Wenn dann Geld von staatlicher Seite kommt, ist das erst einmal eine gute Kombination.
Leider bleibt es in vielen Fällen nicht bei diesem Optimalszenario. Denn wie man im vorliegenden Fall sieht, sind die Fördermittel an die deutschen Gesellschaften, also die Tochtergesellschaften, geflossen, obwohl deren wirtschaftliches Überleben davon abhängt, wie stabil der im Ausland sitzende Mutterkonzern ist.
Politik als Mitspieler – oder als Zaungast
Das führt uns nun zur zentralen Frage: Was kann oder sollte die Politik daraus lernen? Zunächst vielleicht, dass es für erfolgreiche Industriepolitik nicht reicht, nur auf die deutschen Gesellschaften zu schauen, wenn diese als Gesellschafter Unternehmen im Ausland haben.
Man muss verstehen, wie Konzerne und deren Strukturen tatsächlich funktionieren. Man könnte es schon als wirtschaftlich naiv bezeichnen, wenn die rechtliche Eigenständigkeit von GmbHs in Deutschland als Garantie für Beständigkeit interpretiert wird.
Sodann: Fördermittel sollten künftig an Bedingungen geknüpft werden, die über die deutschen Unternehmen hinausblicken. Was ich damit konkret meine:
- Wenn Fördergelder fließen sollen, dann müsste die Bonität der Gesellschafter von den deutschen Empfängerunternehmen geprüft werden, insbesondere wenn dies bestimmende Unternehmen im Ausland sind.
- Die Muttergesellschaften müssten über ihre Strategien verstärkt berichten. Natürlich sollen dabei keine Unternehmensgeheimnisse verraten werden müssen. Aber zumindest muss es bei den Muttergesellschaften für Tochterunternehmen ein gewisses langfristiges Engagement geben, welches kommuniziert werden muss (dass es dann auch anders kommen kann, ist immer möglich und auch verständlich – aber zumindest kann das dafür sorgen, dass es gewisse Äußerungen zum Engagement geben muss).
- Es sollte eine Art Frühwarnsystem geben, wenn sich zentrale Kenngrößen im Ausland verschlechtern, und diese müssten auch zur Kenntnis genommen werden.
- Und schließlich: es sollte über Rückzahlungsverpflichtungen bei Standortaufgabe innerhalb eines bestimmten Zeitraums nachgedacht werden.
Schließlich gibt es noch einen Aspekt: Politik darf nicht nur auf die Schaffung von Arbeitsplätzen im Jetzt schauen, sondern muss sich fragen, wie lange diese Jobs wirklich sicher sind. Denn: Was in einer Wahlperiode als Erfolg verkauft wird, kann in der nächsten schon ein industriepolitischer Totalschaden sein. Ohne eine entsprechende belastbare Planung sollten Fördermitteln also nicht zugeteilt werden.
Und die Gesellschaft?
Und was wir schließlich als Gesellschaft verstehen müssen: Standort- beziehungsweise Industriepolitik ist keine PR-Übung mit blauem Baggerband, Riesenschere zum Zerschneiden des Bandes und einem Gläschen Sekt. Wenn, wie bei den Beispielen Northvolt und Meyer Burger, die Transformation von Wirtschaft und Energie gelingen soll, dann geht das nur mit stabilen Unternehmen.
Es geht nicht mit Konstruktionen, bei denen die deutsche Tochter den Hoffnungsträger spielt – und die Fördermittel kassiert -, während im Hintergrund die Muttergesellschaft wie eine Art „Black Box“ keine Einblicke erlaubt und dann mit finanzieller Schieflage überrascht.
Solange also deutsche Fördermittel großzügig fließen, ohne strategische Bindung an Entscheidungen der entscheidenden Unternehmen im Ausland, wird immer Risiko bestehen, dass Milliarden in schöne Fassaden investiert werden, ohne dass sich Substanz dahinter findet.
Fazit: Auswirkungen einer Insolvenz zwischen Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft
Die Fälle Northvolt und Meyer Burger sind nun beileibe keine Einzelfälle. Was sie aber auf jeden Fall sind: Weckrufe. Wer deutsche Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen unterstützt, muss verstehen, wie die Macht in Unternehmensverbindungen verteilt ist.
Und wer mit Steuergeldern Standorte fördert beziehungsweise fördern will, darf nicht bei der juristischen Fassade stehenbleiben, sondern muss die wirtschaftlichen Umstände und Verbindungen zwischen den einzelnen Unternehmen in die Entscheidungen mit einbeziehen. Sonst fördern wir nicht die Zukunft, sondern Papiertiger. Und das mit Ansage.
Auch interessant: