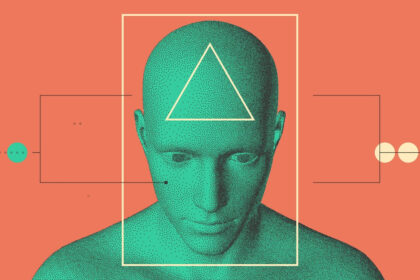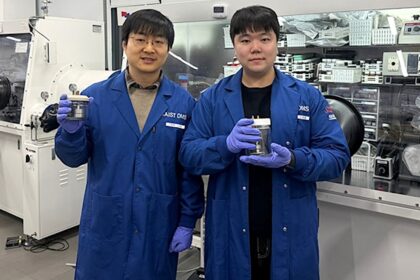Die EU hat eine Mission: Wasserstoff soll den Schwerlastverkehr dekarbonisieren und Europas Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. Laut einer aktuellen Studie aus Schweden könnten die EU-Vorgaben für Wasserstoff-Tankstellen jedoch zu Millionenverlusten führen.
Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR): So heißt eine Verordnung der EU zur Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Sie soll den Ausbau der Lade- und Tankinfrastruktur für Antriebsstoffe wie Strom und Wasserstoff regeln.
Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Dafür sollen im Abstand von jeweils 200 Kilometern entlang wichtiger Verkehrsachsen Wasserstoff-Tankstellen entstehen – zusätzlich mindestens eine Station pro städtischem Knotenpunkt.
Was nach Fortschritt klingt, könnte in der Praxis allerdings zu Verlusten in Millionenhöhe führen. Das ist zumindest das Ergebnis einer aktuellen Studie aus Schweden.
Wasserstoff-Tankstellen als teure Ladenhüter?
Laut Wissenschaftler der Chalmers University of Technology in Göteburg weist die AFIR-Verordnung der EU Schwächen auf. Mithilfe eines neuen Modells wiesen die Forscher nach, dass die geplante Verteilung von Wasserstoff-Tankstellen für einigen Ländern nicht bedarfsgerecht ist.
Auf Basis der Daten von 600.000 Frachtstrecken quer durch Europa simulierten sie, wie sich der Verkehr von wasserstoffbetriebenen Langstrecken-Lkw bis zum Jahr 2050 entwickeln könnte. Dabei wurde deutlich, wo eine besonders hohe Nachfrage an Wasserstofftankstellen entstehen dürfte.
„Unser Modell zeigt, dass Frankreich bis 2050 eine siebenmal höhere Kapazität benötigen wird, als es die EU für 2030 vorsieht“, soJoel Löfving, Doktorand im Fachbereich für Mechanik und Seefahrt an der Chalmers University. Die Konsequenz: Unterversorgung, sobald emissionsfreie Lkw Fahrt aufnehmen.
Gleichzeitig zeigt die Studie, dass Länder wie Bulgarien, Rumänien oder Griechenland deutlich weniger Verkehr aufweisen – aber trotzdem gezwungen sind, eine Infrastruktur aufzubauen, die wahrscheinlich kaum genutzt würde. Die Folge: Investitions- und Betriebskosten in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Euro jährlich – für weitgehend ungenutzte Anlagen.
EU-Pläne zwischen Klimaziel und Realität
Neben Verkehrsvolumen und Distanzen berücksichtigt das Chalmers-Modell auch topografische Daten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Ein zentrales Ergebnis: Das geografische Gelände beeinflusst den Energieverbrauch von Lkw stärker als bisher angenommen.
„Viele Modelle arbeiten mit einem durchschnittlichen Energieverbrauch pro Kilometer“, so Löfving. Beziehe man Steigungen und Geschwindigkeiten mit ein, verändere sich das Profil erheblich. „Das liefert eine realistischere Grundlage dafür, wo die Infrastruktur tatsächlich gebraucht wird.“
Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf Langstreckentransporte von über 360 Kilometern. Kürzere Distanzen werden künftig voraussichtlich von batterieelektrischen Nutzfahrzeugen übernommen.
Wir haben uns an der technologischen Entwicklung im Lkw-Bereich orientiert. Vieles deutet darauf hin, dass Batterien für kürzere Strecken geeignet sind, während Wasserstoff für längere Distanzen eine wichtige Ergänzung sein könnte.
Wasserstoff-Tankstellen: In Österreich bereits Vergangenheit
Der Bau einer mittleren Wasserstoff-Tankstelle kostet laut Branchenverband Hydrogen Europe rund vier Millionen Euro. Zwar wird erwartet, dass dieser Wert im Laufe der Zeit auf unter drei Millionen Euro sinken wird. Dennoch zeigen Erfahrungen aus der Praxis, dass eine Station erst dann rentabel ist, wenn sie zehn bis 15 Lkw pro Tag bedient.
Was unrealistische Planung in der Praxis bedeutet, sieht man beispielsweise in Österreich. Dort wurden sämtliche öffentlichen Wasserstoff-Tankstellen wieder geschlossen, da sich Nachfrage und Wirtschaftlichkeit nicht deckten. Denn: Auf Österreichs Straßen sind schlicht nicht genug Fahrzeuge mit Brennstoffzellen-Antrieb unterwegs.
Forscher wollen Politik positiv beeinflussen
Bisher hält die EU an ihrer Vision fest – obwohl der Europäische Rechnungshof schon im vergangenen Jahr einen „Realitätscheck“ forderte. Die Chalmers-Studie wurde bereits in politische Diskussionen in Schweden und auf EU-Ebene herangezogen. Die Wissenschaftler konnten eigenen Angaben zufolge bereits Input für die geplante Evaluierung der AFIR-Verordnung im Jahr 2026 liefern.
Löfving hofft, dass die Analyse die Weiterentwicklung der Gesetzgebung beeinflusst: „Durch unseren langfristigen Ansatz konnten wir einen Beitrag zur Frage leisten, wie ein wirtschaftlich tragfähiges Netz von Wasserstofftankstellen aufgebaut werden kann – als Grundlage für einen funktionierenden Markt für schwere Wasserstofffahrzeuge.“
Auch interessant: