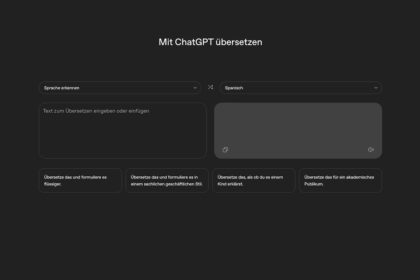Forschern aus Tokyo ist es gelungen, den Energieverlust von Elektroautos zu entschlüsseln. Sie lösten ein Problem, das lange Zeit Rätsel aufgab. E-Autos könnten dadurch noch effizienter werden.
Ob E-Autos, Waschmaschinen oder Windräder: Viele Dinge werden von Elektromotoren angetrieben. Damit sie effizient arbeiten, sollten sie möglichst wenig Energie verschwenden. Doch rund ein Drittel der Energieverluste entsteht im Motor selbst, genauer gesagt in dem Material, aus dem der Kern besteht: dem Elektrostahl.
Diese Verluste entstehen, wenn das Magnetfeld im Motor wiederholt seine Richtung wechselt. Denn das bringt die magnetischen Bereiche im Material durcheinander, die sich jedes Mal neu ausrichten müssen.
Dabei geht Energie verloren, vergleichbar mit einem schweren Möbelstück, das ständig hin- und hergeschoben wird. Diese Art von Energieverlust wird auch als magnetischer Hystereseverlust bezeichnet.
Energieverlust von Elektroautos: Neue Methode bringt Licht ins Dunkel
Wissenschaftler der Tokyo University of Science haben nun eine Methode entwickelt, mit der sich erstmals genau erkennen lässt, wo und warum diese Verluste entstehen. Denn obwohl das Problem seit Jahrzehnten bekannt ist, war bislang unklar, was genau im Inneren des Materials geschieht.
Die Forscher nutzen eine Kombination aus moderner Datenanalyse und einem physikalischen Modell namens Ginzburg-Landau-Modell. Dieses half dabei, die Veränderungen im Material als eine Art Energielandschaft sichtbar zu machen. Es handelt sich um eine Art Geländemodell mit Bergen und Tälern, die anzeigen, wo es im Material „leicht“ oder „schwer“ ist, die Magnetrichtung zu ändern.
Das Team analysierte mikroskopische Bilder des Elektrostahls und fand heraus, dass es Stellen im Material gibt, an denen sich die magnetischen Bereiche besonders schwer bewegen lassen. Meist liegen diese an den sogenannten Korngrenzen. Das sind Übergänge zwischen verschiedenen Kristallen im Metall. Dort treffen „fördernde“ und „hemmende“ Kräfte aufeinander, was zu besonders hohen Energieverlusten führen kann.
Warum das wichtig ist
Durch die neue Methode konnten die Forscher die Problemzonen automatisch erkennen, ohne sie von Hand im Mikroskop suchen zu müssen.
Mit den neuen Erkenntnissen könnten Hersteller von Elektromotoren ihre Materialien gezielter verbessern und so Motoren bauen, die weniger Strom verbrauchen und langlebiger sind. Das würde nicht nur beim Klimaschutz helfen, sondern auch bei der Entwicklung besserer Elektroautos oder effizienterer Industrieanlagen.
Auch interessant: