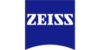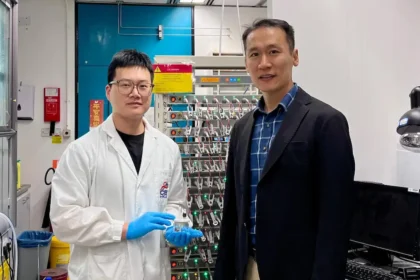Extremwinde bringen mehr als 40 Prozent der bestehenden und geplanten Offshore-Windparks in Asien und Europa an ihre Belastungsgrenzen. Das zeigt eine aktuelle Studie aus China.
Erst kürzlich forderte ein Taifun auf den Philippinen viele Todesopfer. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 Kilometern pro Stunde fegte „Kalmaegi“ über den südostasiatischen Inselstaat.
Während die Menschen noch mit den Folgen kämpfen, bahnt sich bereits der nächste Wirbelsturm an. „Fung-Wong“ droht sogar, sich zu einem Supertaifun zu entwickeln. Diese extremen Wetterereignisse sind eine katastrophale Demonstration der Klimakrise und werde immer mehr zur Bedrohung der globalen Energiewende.
Extremwinde bedrohen Offshore-Windparks
Windenergie ist eine Schlüsselkomponente der globalen Umstellung auf erneuerbare Energien. Besonders Offshore-Windparks müssen rauen Umgebungen standhalten können. Sie werden mit unterschiedlichen maximalen Windgeschwindigkeits-Auslegungslasten gebaut, abhängig von ihrer Klasse.
Turbinen der Klasse III sind bis zu einer Grenze von 135 Kilometer pro Stunde zertifiziert. Modelle der Klasse II sind für Windgeschwindigkeiten bis 153 Kilometer pro Stunde ausgelegt und die stabilste Ausführung, Klasse I, widersteht Geschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometer pro Stunde.
Allerdings zeigt eine aktuelle Studie von Forschern der chinesischen Southern University of Science and Technology (SUSTech), dass über 40 Prozent der bestehenden und geplanten Offshore-Windparks in Europa und Asien Windgeschwindigkeiten ausgesetzt sind, die über der maximalen Auslegungslast einiger Turbinenklassen liegen.
Betroffen sind vor allem Länder wie China, die Philippinen, Japan und Vietnam, aber auch das Vereinigte Königreich, die Türkei, Deutschland sowie weitere an Nord- und Ostsee gelegene Länder.
Die Belastbarkeit von Windturbinen
Die Belastbarkeit von Windturbinen wird durch die Fünfzig-Jahres-Wiederkehrperiode der Windgeschwindigkeit (U50) bestimmt. Dabei handelt es sich um einen Schlüsselparameter, der die maximale Windgeschwindigkeit definiert, die eine Turbine über 50 Jahre standhalten muss.
Studienautor Yanan Zhao und Kollegen analysierten stündliche ERA5-Windgeschwindigkeitsdaten aus dem Zeitraum zwischen 1940 und 2023. Dabei fanden sie heraus, dass die Belastungsgrenze immer häufiger überschritten wird. Der Analyse zufolge nahmen die extremen Windgeschwindigkeiten in etwa 63 Prozent der ozeanischen Küstenregionen zu.
Klimawandel verantwortlich für Extremwinde
Der Anstieg der extremen Winde ist den Forschern zufolge keine zufällige Schwankung, sondern eine direkte Folge des globalen Klimawandels. Sie bringen die Zunahme der Windgeschwindigkeiten eng mit der Veränderung der Zyklonaktivität sowohl tropischer als auch extratropischer Wirbelstürme in Verbindung.
In den betroffenen Windparks sind die Turbinen demnach einem doppelten Risiko ausgesetzt: Sie müssen nicht nur die bisherigen Spitzenwerte aushalten, sondern auch die zunehmende Intensität künftiger Wetterereignisse bewältigen.
Diese Entwicklung stellt die kritische Design-Messgröße U50 massiv auf die Probe. Überschreiten immer stärkere Stürme die festgelegten Obergrenzen, drohen vorzeitige Materialermüdung, häufigere Abschaltungen und letztlich höhere Wartungskosten oder gar der Ausfall teurer Infrastruktur.
So halten Offshore-Windparks gegen Extremwinde stand
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich die Windenergieinfrastruktur an den sich stets verändernden Klimawandel anpassen müssen. Nur so lassen sie sich künftig vor Extremwinden schützen. Damit einher geht ein Weckruf an Politik, Windpark-Betreiber und Ingenieure.
Sie müssen zunächst die Design-Standards neu bewerten und die Belastungsgrenzen der Turbinen an die gestiegenen Extremwerte anpassen, sodass künftige Projekte von vornherein mit höheren Designlasten für eine längere Lebensdauer konzipiert werden.
Außerdem ist eine Optimierung der Standortwahl entscheidend: Durch präzise Analysen regionaler Windtendenzen sollten neue Windparks vorrangig in Gebieten mit einem geringeren Anstieg extremer Winde geplant werden.
Gleichzeitig bedarf es einer Investition in die technologische Resilienz, indem stabilere Materialien, intelligentere Kontrollsysteme und verbesserte Abschaltmechanismen eingesetzt werden. So können die Anlagen auch bei extremen Wetterereignissen geschützt werden.
Auch interessant: