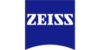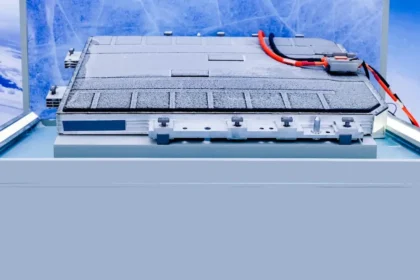KI-Agenten werden 2026 als „digitale Belegschaft“ in Unternehmen Arbeitsschritte planen, Tools nutzen, auf Daten zugreifen und weitgehend selbständig handeln. Was dabei kaum berücksichtigt wird: Es müssen sich völlig neue Organisationsrollen rund um Agenten bilden. Eine Einschätzung.
Wenn bisher von Automatisierung mit KI-Agenten gesprochen wurde, lag der Fokus dabei meist auf dem Menschen als Nutzer:innen: Letztentscheidungen und Steuerungen sollen immer beim Menschen verbleiben.
Ich denke, das wird sich 2026 ändern. Unternehmen werden ihre Unternehmensprozesse nicht mehr primär für menschliche User, sondern zunehmend für eine Art „digitale Hybridbelegschaft“ aus Menschen und KI-Agenten bauen.
Dabei werden in den Prozessen Agenten so berücksichtigt, dass diese selbstständig Workflows orchestrieren, Entscheidungen vorbereiten oder sogar treffen können – mit allen Elementen, die bisher rein menschlichen Teams vorbehalten waren.
KI-Agenten werden damit zu dauerhaften, adressierbaren Einheiten, die man wie menschliche Kolleg:innen ansprechen kann – mit Aufgaben, Zielen und Verantwortlichkeiten.
KI-Agenten: Neue Rollen für eine agentische Organisation
Wenn aber tatsächlich KI-Agenten als digitale Mitarbeiter:innen agieren sollen, dann braucht es dazu Menschen, die diese „Teams“ gestalten, steuern und verantworten, woraus sich völlig neue Rollen für solche Angestellte ergeben, beispielsweise als AI-Orchestrator:innen, AI-Governance-Architekt:innen, Datenqualitäts-Kurator:innen oder Business-Process-Agent-Designer.
Menschen in diesen Rollen werden die Prozesse, die für eine Einbindung von Agenten benötigt werden, neu definieren und das Verhalten der Agenten entsprechend im laufenden Betrieb überwachen.
Damit verschieben sich aber auch Verantwortlichkeiten: Wer entscheidet über die Ziele eines KI-Agenten? Wer legt fest, wann dieser gestoppt werden muss?
Und wer bewertet, ob das Verhalten desAgenten noch im Rahmen der Unternehmenswerte liegt? Genau hier entstehen neue Führungsaufgaben für Führungskräfte und Prozessverantwortliche.
Märkte, in denen Agenten mit Agenten verhandeln
Wenn KI-Agenten immer mehr Aufgaben übernehmen, dann wird sich auch die Ansprache neu ausrichten. Heute richten Unternehmen ihre Marken, Websites und Angebote an menschlichen Kund:innen aus.
Doch je verstärkt Agenten Einkaufsentscheidungen vorbereiten oder sogar treffen, desto stärker werden Veränderungen erforderlich. Marketing-Teams werden lernen müssen, nicht nur Menschen, sondern auch KI-Agenten anzusprechen.
Auf vielen Plattformen wird es dabei zunehmend Systeme geben, die direkt mit anderen Agenten kommunizieren. Die bisherige „Customer Journey“ wird somit verstärkt zu einem KI-Agenten-Protokoll.
Erfolgreich werden meiner Ansicht nach diejenigen Unternehmen, die früh damit beginnen, ihre Produkte so zu beschreiben, zu standardisieren und mit Triggern zu versehen, dass KI-Agenten sie zuverlässig finden, verstehen und einordnen können.
Emergenz und Schwarmverhalten: Wenn das System mehr wird als die Summe seiner Agenten
Dabei sollte einem Aspekt ein besonderes Augenmerk geschenkt werden, nämlich dem sog. „emergenten Verhalten“ von Multi-Agenten-Systemen. Damit sind komplexe, neuartige Muster oder kollektive Fähigkeiten gemeint, die aus dem Zusammenspiel vieler einzelner Agenten entstehen, obwohl sie keinem dieser Agenten explizit einprogrammiert wurden. Dieses Verhalten, nicht direkt geplant, ergibt sich aus der Dynamik der Interaktionen von KI-Agenten.
Das ist nicht zwangsläufig gefährlich, aber es ist neu und verlangt von Unternehmen ein neues Denken und Vorgehen. Wurde bisher KI als klar abgrenzbares „System“ gesehen, muss in einem Team aus Dutzenden oder Hunderten Agenten nicht nur die einzelne Einheit funktionieren, sondern auch ihre Interaktionen mit anderen KI-Agenten.
Koordinationsfehler, Endlosschleifen, Prioritätenkonflikte oder sogenannte „Koalitionen“ von Agenten, die unbeabsichtigt eine bestimmte, identische Strategie verfolgen, sind dabei ein paar der möglicherweise auftretenden Probleme.
Agentenmanagement in Unternehmen ist somit nicht nur eine Frage des „richtigen Tools“, sondern eine Frage der unternehmerischen Agentenarchitektur zur Vermeidung riskanter Interaktionseffekte von KI-Agenten.
Vollautonome KI-Agenten als Ziel?
Wenn man nun bedenkt, dass wir uns mit KI-Agenten auf ein völlig neues Terrain begeben, ohne sowohl die Risiken von einzeln agierenden als auch von gemeinsam agierenden Agenten erfassen oder absehen zu können, dann müssen wir uns eine Frage stellen: Wollen wir wirklich zum jetzigen Zeitpunkt schon vollautonome Agenten entwickeln?
Denn je größer der Handlungsspielraum solcher Agentensysteme ist und je wenig absehbar die Risiken dabei sind, desto schwerer lassen sich eben diese Risiken wie Missbrauch, Zielverschiebung oder unerwartete Nebenwirkungen kontrollieren.
Was passiert beispielsweise, wenn KI-Agenten unerwartet Dateien löschen, Daten verschieben oder Konfigurationen verändern, weil die gestellten Vorgaben zu unpräzise oder die Systemgrenzen zu schwach definiert waren?
Begrenzte Autonomie statt unbegrenztes Risiko
Schon heute ist, wie ich aus eigener Beobachtung sagen kann, das Problem in Unternehmen das Abbilden von Prozessen in einer Art und Weise, dass diese Prozesse von einem KI-Agenten übernommen werden können.
Was passiert denn, wenn diese ungenau erfassten Prozesse einem Agenten übergeben werden? Governance und Risikomanagement müssen erst entwickelt und implementiert werden, bevor eine Übergabe von Aufgaben an KI-Agenten erfolgt.
Wichtig ist mir an dieser Stelle zu erwähnen: Mir geht es nicht darum zu proklamieren, dass der Einsatz von KI-Agenten auf immer und ewig zu gefährlich ist. Das kann ich gar nicht absehen, wie niemand sonst auch.
Was ich aber sage ist, dass es derzeit erst einmal darum gehen sollte, KI-Agenten mit einer Art „begrenzten Autonomie“ auszustatten, basierend auf klar umrissenen Aufgaben mit entsprechenden Eingangs- und Ausgangsbedingungen, definierten Stopp-Kriterien und nachvollziehbaren, überprüfbaren Entscheidungswegen. So können die Mitarbeitenden den Umgang und die Risiken von Agenten besser verstehen und einordnen.
KI-Verordnung als Gestaltungsrahmen
Und noch etwas sollte bedacht werden: 2026 tritt die vollständige Anwendung der KI-Verordnung der Europäischen Union in Kraft, mit entsprechenden Pflichten, Leitlinien und Strukturvorgaben für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen.
Dieser regulatorische Rahmen wird oft als Bürde, als überzogene Einschränkung und Bremsmechanismus gesehen. Und ja, man kann über den Sinn und Unsinn der Inhalte der KI-Verordnung streiten – muss man sogar.
Mit Blick auf KI-Agenten könnte man aber auch sagen: die KI-Verordnung bietet Orientierung für gute Prozessgestaltung. Denn wer Agenten so baut, dass Entscheidungen nachvollziehbar sind, Datenflüsse dokumentiert werden, Risiken systematisch bewertet und Kontrollpunkte definiert sind (was die Idee hinter den Regelungen der KI-Verordnung ist), erfüllt nicht nur Pflichten, sondern schafft Vertrauen bei Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Partner:innen.
Vision 2026+: Gemischte Teams aus Menschen und Agenten
Blicken wir auf 2026 und über dieses Jahr hinaus, dann kann man erahnen, dass der Einsatz von KI-Agenten weit über reine Produktivitätszuwächse hinausgehen wird.
Wenn KI-Agenten zunehmend eigenständiger werden, wenn neue Rollen für ihre Gestaltung und Überwachung entstehen und wenn Multi-Agenten-Systeme zu einer Art digitalem Betriebssystem für Unternehmensprozesse werden, dann verschiebt sich die Frage, wie wir Unternehmen mit einer digitalen Hybridbelegschaft überhaupt definieren.
Für Unternehmen könnte das bedeuten, sich nicht nur zu fragen, welche Jobs durch den Einsatz von KI-Agenten wegfallen könnten, sondern zu beginnen, ihre Unternehmensorganisation aktiv um diese neuen Möglichkeiten herum zu gestalten.
Welche Aufgaben sollten bewusst beim Menschen bleiben, weil sie Urteilsvermögen, Kreativität, soziale Kommunikation oder echte Verantwortung erfordern? Welche Aufgaben lassen sich so strukturieren, dass Agenten sie zuverlässig übernehmen können?
Und wie sieht Führung aus, wenn ein Teil des Teams keine Menschen, sondern Systeme sind, die trotzdem Ziele, Regeln und Feedback brauchen?
KI-Agenten als Spiegel für Strukturen
Wird über den Einsatz von KI-Agenten diskutiert, dann geht es meistens um schnellere Prozesse, weniger Routinearbeit, bessere Daten. Mindestens genauso wichtig sind jedoch die Fragen, die Agenten an uns zurückspiegeln: Wie organisieren wir Verantwortung in Systemen, in denen Entscheidungen nicht mehr nur von Menschen getroffen werden?
Welche Rollen, Fähigkeiten und interne wie externe Regulierungen brauchen wir, um Agenten sinnvoll zu führen und robuste, vertrauenswürdige agentische Systeme aufzubauen?
2026 wird nicht das Jahr werden, in dem KI-Agenten Menschen ersetzen. Ich denke vielmehr, es wird das Jahr werden, in dem Unternehmen lernen, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Wer jetzt beginnt, eine Art unternehmerisches Agenten-System zu entwerfen, mit klaren Prinzipien für begrenzte Autonomie, Verantwortlichkeiten, Strukturen und Überwachung, verschafft sich einen Vorsprung, der über KI-Agenten als simple Werkzeuge hinausgeht.
Denn die eigentliche strategische Ressource der nächsten Jahre ist nicht der nächste Agent selbst, sondern die Fähigkeit, ihn sinnvoll und nutzbringend in die Unternehmensprozesse einzubetten.
Auch interessant: