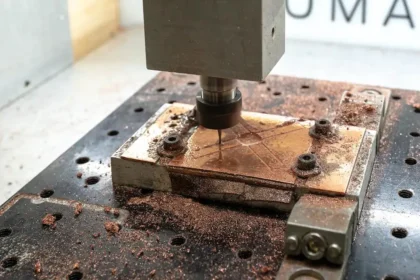Agri-Photovoltaik birgt ein vollkommen unterschätztes Potenzial. Das geht aus aktuellen Studien hervor. Demnach übertrifft das Flächenpotenzial die gesamten deutschen Solar-Ausbauziele. Die Hintergründe.
Neue Erkenntnisse des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE zeigen: Agri-Photovoltaik – also die Kombination aus landwirtschaftlicher Nutzung und Solarstromerzeugung – birgt ein bislang unterschätztes Potenzial für die Energiewende in Deutschland.
Das Forschungsinstitut hat erstmals sämtliche Arten landwirtschaftlicher Flächen umfassend analysiert. Das Ergebnis: Allein auf den am besten geeigneten Flächen könnten 500 Gigawatt Solarleistung installiert werden. Das ist deutlich mehr als das für 2040 vorgesehene Ausbauziel.
Agri-Photovoltaik: Klimaschutz vom Acker
Für ihre Untersuchung nutzten die Forscher geografische Informationssysteme und entwickelten zwei umfangreiche Kriterienkataloge, um optimale Flächen zu identifizieren.
„Es ist die erste Studie in Deutschland, die für die Identifikation geeigneter Standorte alle Arten landwirtschaftlicher Flächen betrachtet, also Dauergrünland, Ackerfläche und Dauerkulturen wie Obstbau, Wein oder Beeren“, erklärt Studienautorin Salome Hauger.
Der erste Kriterienkatalog der Studie berücksichtigte geografische Faktoren sowie rechtliche und behördliche Anforderungen. Er unterscheidet dabei zwei Szenarien:
- Szenario eins schließt Flächen aus, die wegen harter Restriktionen wegfallen, beispielsweise Naturschutzgebiete.
- Szenario zwei schließt Flächen nach harten und weichen Restriktionen aus. Dazu gehören beispielsweise Flora-Fauna-Schutzgebiete. Daher ist es naturschutzfreundlicher.
In der Potenzialanalyse ergeben sich in Szenario eins 7.900 Gigawatt Peak und in Szenario zwei 5.600 Gigawatt Peak installierbare Photovoltaik-Kapazität – ein Vielfaches der für die Klimaneutralität Deutschlands im Jahr 2045 benötigten Menge.
Index zeigt geeignete Flächen
Der zweite Kriterienkatalog umfasst politisch-wirtschaftliche und agrarökonomische Eignungskriterien, um besonders geeignete Standorte zu finden. Dabei betrachteten die Wissenschaftler beispielsweise die Sonneneinstrahlung, vorhandene Neitzeinspeisungspunkte oder mögliche Synergieeffekte von Dauerkulturen wie Wein oder Obst.
Anschließend wurden alle Kriterien gewichtet. Daraus ergab sich ein Bodeneignungsindex. Er ordnet die Gebiete in fünf Eignungsklassen ein – von am besten bis am wenigsten geeignet.
Agri-Photovoltaik zeigt Potenzial auf lokaler Ebene
Nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch lokal untersuchten die Wissenschaftler das Potenzial für Agri-Photovoltaik in einzelnen Landkreisen und Parzellen. Dazu bezogen sie unter anderem Netzdaten der lokalen Verteilnetzbetreiber ein.
Im Rahmen von drei Szenarien wurden die identifizierten Flächen unter techno- und agrarökonomischen Gesichtspunkten [im Raum Hamburg] klassifiziert. Demnach sind insbesondere Dauerkulturen im Alten Land und in den Vier- und Marschlanden (bis zu 620 Hektar) optimal geeignet. Auch das Potenzial für Gewächshäuser ist vielversprechend, hier könnten auf 160 Hektar bestehenden Gebäuden fast 50 Megawatt Peak installiert werden.
In Landkreisen wie Ahrenweiler und Breisgau-Hochschwarzwald könnten Agri-Photovoltaik-Anlagen bis zu 16 Prozent des aktuellen Energiebedarfs decken. Ein Problem gibt es allerdings: „Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist die Rolle des Netzausbaus: Das Fehlen von Netzanschlusspunkten ist für viele Flächen ein einschränkender Faktor“, so Salome Hauger.
Die aktuellen Studien liefern eine solide Datengrundlage für politische Entscheidungsträger und die Energiewirtschaft. Sie belegen, dass Agri-Photovoltaik nicht nur helfen kann, Landnutzungskonflikte zu entschärfen, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten kann.
Auch interessant: