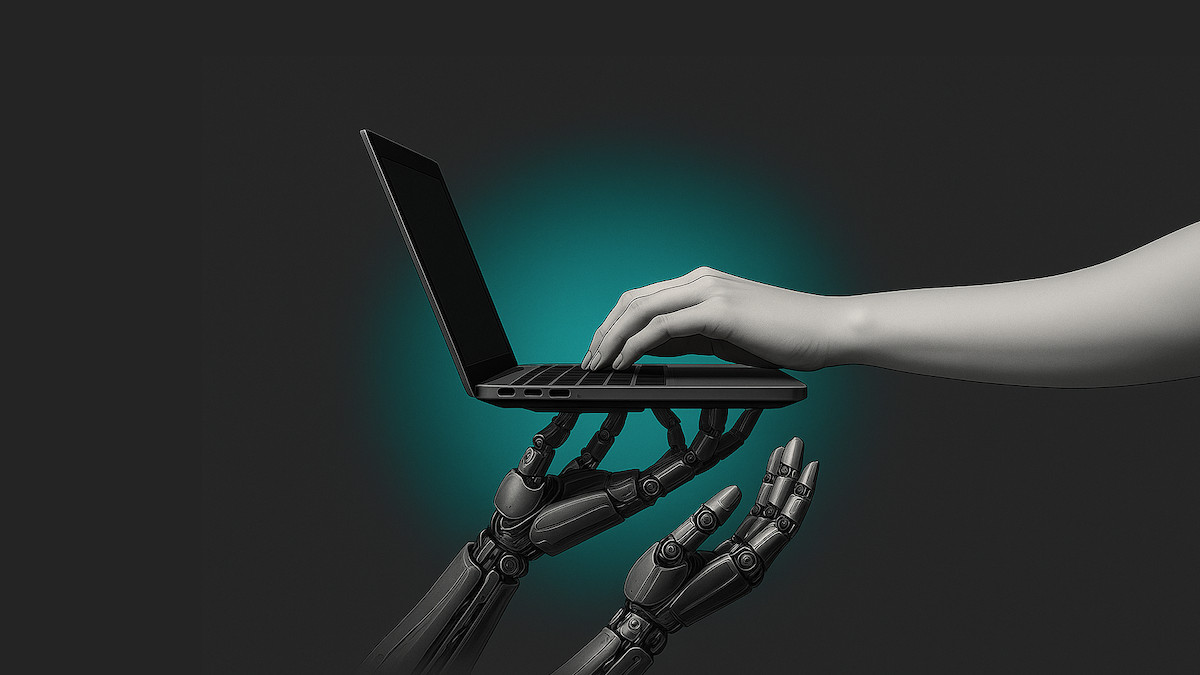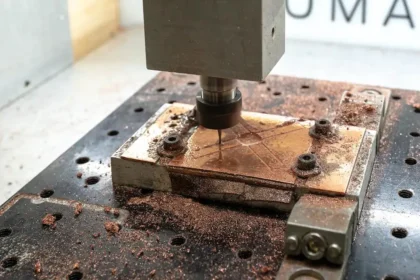Obwohl Unternehmen offiziell kaum KI-Schulungen anbieten, nutzen viele Mitarbeiter längst eigenständig smarte Tools – meist unbeobachtet. Diese Schatten-KI entwickelt sich still, aber kraftvoll weiter. Was bedeutet das für Firmenkultur, Strategie und Innovationskraft? Eine Analyse.
Nur ein Fünftel der Arbeitnehmer in Deutschland hat bislang eine KI-Schulung erhalten. So lautet das zentrale Ergebnis einer aktuellen Bitkom-Studie. Demnach haben sieben von zehn Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber noch nie ein entsprechendes Schulungsangebot erhalten.
Man könnte aus dem Bericht schlussfolgern, dass 80 Prozent der Arbeitnehmer keine KI einsetzen. Ich denke aber, dass sich die Wirklichkeit anders darstellt. Denn wenn ich mit Mitarbeitern meiner Mandanten spreche oder KI-Schulungen bei Verbänden und Organisationen durchführe, dann stelle ich immer wieder fest, dass die Mitarbeiter durchaus KI einsetzen – und zwar täglich, praktisch und oftmals durchaus kreativ.
Nur nicht unbedingt offiziell, also über Unternehmens-Accounts der KI-Systeme. Diese inoffizielle Nutzung, die ich als „stille KI-Revolution“ bezeichne, ist meiner Ansicht nach schon längst in den Unternehmen angekommen. Daraus ergeben sich nicht nur Risiken, sondern auch gewaltige Chancen. Es ist für Unternehmen deshalb wichtig zu verstehen, was hier geschieht und was das für sie bedeutet.
Schatten-KI: Die verborgene Parallelwelt der digitalen Produktivität
Das klassische Vorgehen sieht wie folgt aus: Unternehmen müssen erst mal KI einführen, Tools evaluieren, Schulungen planen, Strategien entwickeln. Bis dahin passiert … nichts? Mitnichten!
In vielen Abteilungen arbeiten vielmehr schon heute Menschen mit privaten Accounts für Tools wie ChatGPT, Google Gemini, Midjourney, Notion AI, Claude oder Microsoft Copilot, ohne dass ihre Vorgesetzten etwas davon wissen – oder es bewusst registrieren.
Diese Form der informellen, inoffiziellen KI-Nutzung nennt man in Anlehnung an die IT-Welt „Shadow AI“ oder „Shadow KI“ – analog zu der Situation in der IT, bei der Mitarbeitende eigene Softwarelösungen nutzen, weil die offiziellen nicht genügen.
Warum die KI-Tools verwendet werden, auch wenn Unternehmen diese noch nicht offiziell eingeführt haben, sind leicht nachvollziehbar, wenn man sich nur einmal typische Situationen anschaut, bei denen diese Tools Erleichterungen und Nutzen für die Mitarbeiter bringen.
Wer heute im Marketing arbeitet und für einen Blogartikel zehn Ideen für Überschriften braucht, nutzt ChatGPT zur Ideengenerierung. Wer im Vertrieb ein individuelles Angebot schreiben will, lässt sich durch Claude oder ChatGPT Formulierungen erstellen.
Wer mit IT-Dokumentationen oder seitenlangen Handouts oder Merkblättern kämpft, nutzt Tools für automatische Zusammenfassungen wie NotebookLM. Und wer PowerPoint-Präsentationen erstellen muss, probiert Tools wie Gamma oder Beautiful.ai aus. Gemeinsam haben all diese Tools, dass sie für die Mitarbeiter unmittelbaren Nutzen bringen, weil:
- sie leicht zugänglich sind,
- ihre Anwendung intuitiv ist,
- die Ergebnisse oft verblüffend gut sind, zumindest im Vergleich zu der Situation, die man hätte, wenn die Tools nicht verwendet werden, und.
- die Frustration über die bestehenden unternehmensinternen Prozesse groß ist.
Problematisch ist nun dabei, dass die Verwendung der KI-Tools nebenbei, schnell und ungesteuert passiert, meist komplett unsichtbar für das Management.
Was nicht sichtbar ist, wird auch nicht bewertet
Das große Problem dabei ist: Was nicht als offiziell eingeführte Technologie gilt, taucht in keiner Analyse, keinem Reporting, keinem Audit auf. Es wird nicht bewertet, nicht eingeordnet, nicht weiterentwickelt – auch nicht im Hinblick auf auftauchende oder sich verfestigende Schwierigkeiten und Herausforderungen. Die informelle KI-Nutzung bleibt im verborgenen – mit allen Konsequenzen:
- Wie sieht es aus mit dem Datenschutz: Werden sensible Kundendaten unbewusst in US-Clouds hochgeladen?
- Wie ist die Qualität der von KI-Tools produzierten Outputs zu beurteilen: Welche Ergebnisse verlassen das Haus, ohne menschliche Kontrolle?
- Wie wird mit neuem Wissen hinsichtlich Ausgabeerzielung – Prompting – umgegangen: Welche innovativen Prompt-Strategien stehen dem Unternehmen nicht zur Verfügung, weil niemand anderes als der Mitarbeiter, der sie anwendet, von ihnen weiß?
Das alles ist schon schwierig. Doch noch gravierender ist aus meiner Sicht, dass Unternehmen enormes Potenzial verschenken, wenn beziehungsweise weil sie eine Dynamik nicht anerkennen, die längst Realität ist.
Schatten-KI: Mitarbeiter als Avantgarde
Oft wird nämlich übersehen, dass diese Nutzung von KI-Tools im Verborgenen kein Zeichen von Regelbruch oder illoyalem Verhalten ist, sondern ein im Grunde beeindruckendes Beispiel für Eigeninitiative. Viele Mitarbeiter wollen effizienter arbeiten. Sie spüren den Druck, immer mehr in kürzerer Zeit zu leisten.
Sie verstehen, dass die bisherigen Prozesse im Unternehmen für das, was sie erreichen wollen und können, nicht ausreichen. Und sie erkennen das Potenzial der neuen KI-Tools und handeln aus einer Mischung aus Neugier, Pragmatismus und Überforderung.
In gewisser Weise sind also die Mitarbeiter ihren eigenen Unternehmen einen Schritt voraus. Die Revolution kommt von unten – nicht aufgrund eines Strategiepapiers. Ich glaube, das ist kein Risiko. Das ist eine Chance. Wenn man sie ergreift.
Was Unternehmen tun können
Wenn ein Unternehmen heute noch überlegt, „ob sich KI für uns überhaupt lohnt“, hat es die falsche Frage im Kopf. Die richtige Frage lautet vielmehr: Wie kann ich das Wissen meiner Leute sichtbar, sicher und skalierbar machen?
Dafür braucht es nicht riesige Transformationsprogramme. Es reicht oft, einen kulturellen und strukturellen Rahmen zu schaffen, in dem die Mitarbeiter bewusst handeln können:
- Erheben statt verbieten: Anstatt die Nutzung von KI-Tools zu unterbinden, sollten Unternehmen offen fragen, wo, wie und warum Tools von ihren Mitarbeitern genutzt werden. Eine anonyme Umfrage reicht oftmals schon aus, um ein erstes Bild zu bekommen.
- Wertschätzen statt sanktionieren: Wer Mitarbeiter wegen inoffizieller KI-Nutzung ermahnt, erstickt Innovationskraft. Wer sie für ihre Kreativität lobt, kann aus ihrem Wissen lernen.
- Wissensräume schaffen: Ob Lunch & Learn, interne Talks, wöchentliche „KI-Quick Wins“ im Intranet oder – was ich gemeinsam mit dem BVI Bundesverband der Immobilienverwalter ins Leben gerufen habe – einen KI-Talk, um sich unter Anleitung von KI-Experten über Best Practices auszutauschen: Wer Plattformen und Formate schafft, auf und in denen Erfahrungen geteilt werden können, schafft eine gemeinsame Lernkultur.
- Spielregeln definieren: Wo sensible Daten im Spiel sind, müssen klare Leitlinien her – etwa über erlaubte Tools, Datenverarbeitung und menschliche Kontrolle. Diese Regeln sollten verständlich und praxisnah sein. Und die Einbindung der Mitarbeiter in die Erstellung solcher Leitlinien schafft schnellere Akzeptanz.
- Mut zur Pilotierung: Anstatt KI erst nach monatelanger Abstimmung einzuführen, können einzelne Abteilungen mit definierten Tools testweise arbeiten und so schnell sog. „Quick Wins“, also schnelle Erfolge, schaffen, die den Mitarbeitern den Nutzen von KI-Tools aufzeigt bzw. denen, die diese Tools schein einsetzen, in der weiteren Verwendung motiviert. Die geschaffenen Ergebnisse helfen dann beim strategischen Ausbau der Verwendung von KI-Systemen in Unternehmen.
Fazit: Die Schattenseite leuchtet heller, als viele glauben
Der Bitkom-Studie zeigt eine Wahrheit in Unternehmen hinsichtlich der Nutzung von KI-Systemen durch die Mitarbeiter – aber nicht das ganze sich daraus ergebende Bild. Der überwiegende Teil der befragten Unternehmen hat Arbeitnehmern bislang zwar keine KI-Schulungen angeboten.
Aber daraus zu schließen, es gäbe kaum KI-Nutzung im unternehmerischen Alltag, ist grundfalsch. Denn unter der Oberfläche hat sich vielmehr längst ein pragmatisches KI-Ökosystem entwickelt. Es ist nicht perfekt, nicht vollständig sicher – aber es ist da und es verfügt über den Willen, Arbeitsabläufe und Prozesse neu zu gestalten.
Die eigentliche Frage ist daher nicht, ob Unternehmen KI einführen sollten. Diese Frage ist meiner Ansicht nach schon von den Mitarbeitern beantwortet worden. Die eigentliche Frage lautet deshalb: Wie lange wollen Unternehmen es sich noch leisten, die stille KI-Revolution in ihren eigenen Reihen zu ignorieren?
Auch interessant: