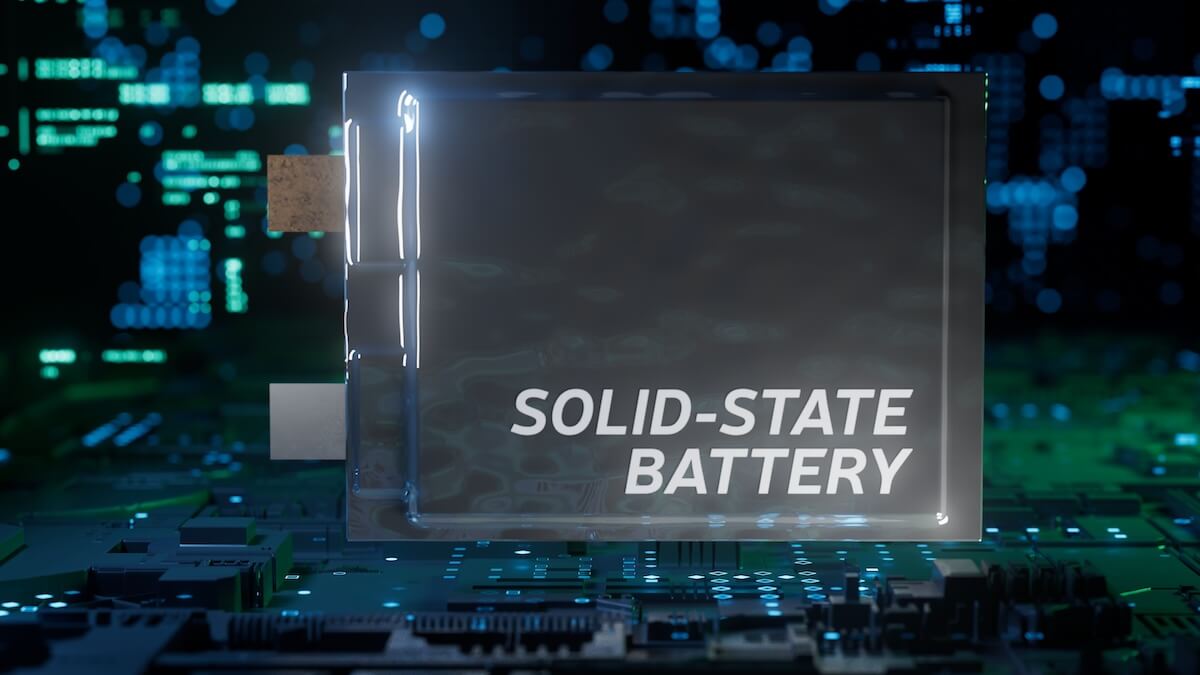Asien spielt eine zentrale Rolle in der Batterietechnologie – sowohl in der Forschung als auch Entwicklung. Doch europäische Hersteller versuchen zunehmend, mit eigenen Entwicklungen Abhängigkeiten zu reduzieren – auch bei der Zukunftstechnologien wie Feststoffbatterien.
Feststoffbatterien gelten als Schlüsselbaustein für die Energiewende. Denn sie können sichere, langlebige und effiziente Speicherlösungen bieten und so die Energiewende vorantreiben.
Doch bisher befindet sich die Technologie noch in der Entwicklungsphase. Eine marktreife Massenproduktion wird erst in den kommenden Jahren erwartet.
Feststoffbatterien aus Europa: Der aktuelle Stand
Dennoch setzen zahlreiche Produktionsstandorte weltweit bereits auf die Herstellung von Feststoffbatterien. So zählt Asien in diesem Jahr beispielsweise 33 Standorte, in Nordamerika sind es 23, Europa kommt auf 17.
Bis zum Jahr 2030 soll China Prognosen des Fraunhofer ISI zufolge eine Produktionskapazität von 156 Gigawattstunden im Bereich der Feststoffbatterien erreichen. Die USA könnten demnach auf rund 120 Gigawattstunden kommen, Europa lediglich auf rund 33 Gigawattstunden Produktionskapazität.
Diese Zahlen prognostizieren für die Zukunft eine starke Abhängigkeit vom asiatischen Markt. Die Hersteller Mercedes-Benz und Stellantis wollen dem entgegenwirken und forschen an Feststoffbatterien aus Europa.
Schaffen es europäische Hersteller zur Marktreife?
Für ihre Bestrebungen auf dem Markt der Festkörperbatterien arbeiten die beiden Automobilkonzerne Stellantis und Mercedes-Benz mit dem US-amerikanischen Batterie-Start-up Factorial Energy zusammen.
Bereits im April dieses Jahres konnte Stellantis nach eigenen Angaben einen „wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung von Festkörperbatterien“ erreichen. Demnach konnte das Unternehmen gemeinsam mit Factorial Energy eine Festkörperbatteriezellen in Automobilgröße mit einer Energiedichte von 375 Wh/kg validieren.
Laut den beiden Unternehmen stellt dies einen wichtigen Schritt „in Richtung kommerzieller Nutzung“ dar. Das belegen auch aktuelle Zahlen im Vergleich. Denn bei einem Tesla Model 3 liegt die Energiedichte bei älteren Modellen zwischen 160 und 180 Wh/kg, bei neueren zwischen 200 und 250 Wh/kg.
Auch die Schnellladefähigkeit ist laut Stellantis enorm. Demnach könne die Batterie von 15 auf 90 Prozent in nur 18 Minuten geladen werden. Bereits im kommenden Jahr wolle der Konzern seine Feststoffbatterien in der Demonstrationsflotte einsetzen.
Mercedes-Benz hingegen verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Zusammen mit Factorial Energy hat der deutsche Autobauer die neue Zellgeneration „Solstice“ entwickelt. Das sulfidbasierte Festelektrolyt-System weist eine Energiedichte von 450 Wh/kg auf. Künftig sollen so Reichweite von mehr als 1.000 Kilometern pro Ladung realistisch werden.
Auch interessant: