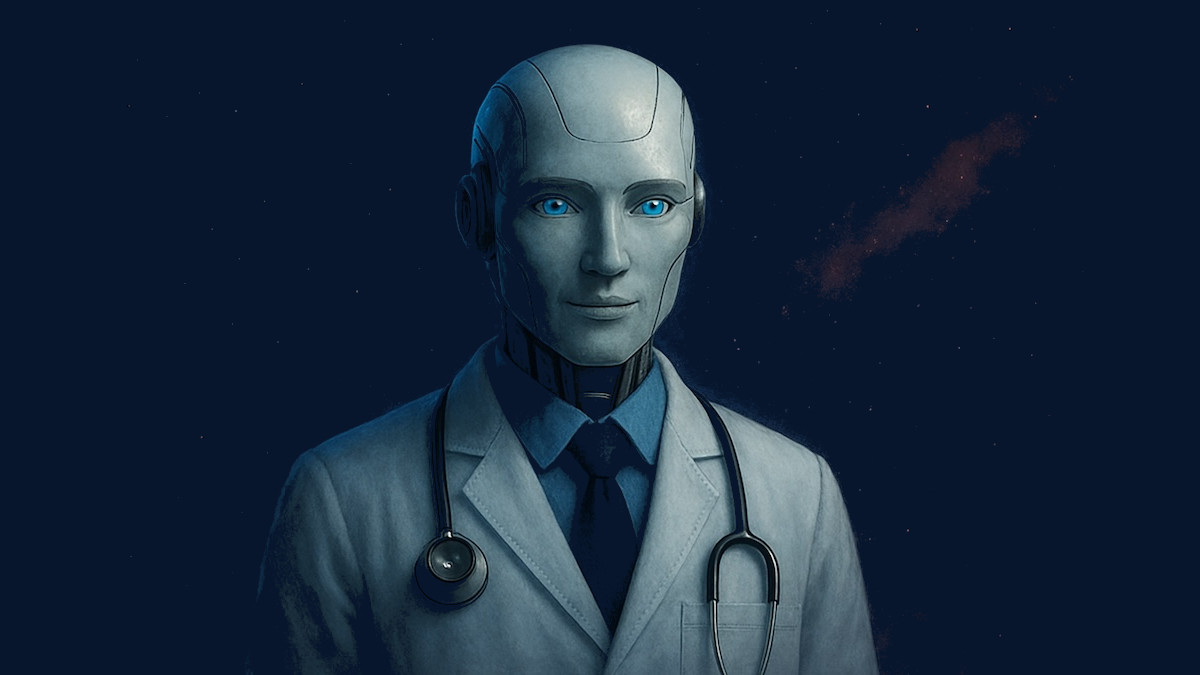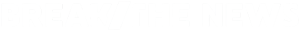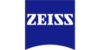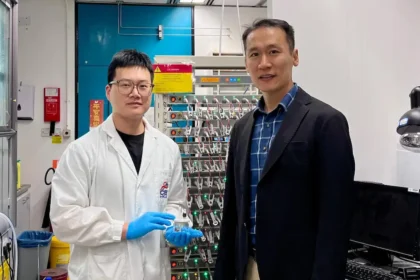KI-Tools können Ärzte entlasten und ihnen mehr Zeit für Untersuchungen und Behandlungen einräumen. Laut einer aktuellen Studie zeigen sich viele Patienten gegenüber Künstlicher Intelligenz in Arztpraxen aber skeptisch – selbst wenn sie nur Verwaltungsaufgaben übernimmt. Auch in der Diagnose offenbaren sich Probleme.
Hintergrund: Skepsis gegenüber KI in Arztpraxen
- Laut Studie der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und des Instituts für Medizinische Informatik der Charité Berlin hat KI das Potenzial, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Doch viele Menschen zweifeln an der Kompetenz von KI, vor allem hinsichtlich medizinischer Fragestellungen. Diese Skepsis betrifft aber nicht nur KI selbst, sondern auch Ärzte, die sie nutzen.
- Eine Studie aus Polen hat wiederum ergeben, dass Ärzte, die bei Krebsuntersuchungen mit KI arbeiten, nach wenigen Monaten deutlich unzuverlässiger sind als zuvor. Bei Darmspiegelungen stellten die Forscher einen ähnlichen Effekt fest. Der Grund: Ärzte würden sich zu schnell an KI gewöhnen und sich auf diese verlassen. Die Forscher raten dazu, die Folgen der Einführung von KI „sorgfältig zu prüfen“.
- KI soll das Gesundheitssystem verbessern. Doch Cyberangriffe können Patientensicherheit, Medizingeräte und die Arbeit von Rettungskräften gefährden. Im Rahmen des Projekts „SecureNeuroAI“ wollen deshalb unter anderem Forscher der Universität Bonn sichere und KI-gestützte Methoden zur Echtzeiterkennung medizinischer Notfälle entwickeln.
Einordnung: KI als Arzt
KI birgt das Potenzial, das überlastete Gesundheitssystem in Deutschland zu entlasten. Doch für viele wirkt ein solcher Fortschritt wie ein Fremdkörper. Denn Technologie, die entlasten soll, kann zu einer Entfremdung zwischen Arzt und Patient führen.
Eines der paradoxesten Probleme im KI-Zeitalter: Je smarter die Maschine, desto mehr stumpfen mitunter ihre Nutzer ab. Denn wenn Ärzte diagnostisch einrosten, weil Algorithmen übernehmen, verliert die Medizin an Glaubwürdigkeit.
KI wird zudem häufig als Wundermittel angepriesen. Doch wer digitale Systeme nutzt, muss sich auch mit ihren Schwachstellen beschäftigen. Manipulierte Gesundheitsdaten sind etwa keine Science Fiction, sondern ein reales Risiko.
Arztpraxen laufen einerseits Gefahr, sich in Fabriken zu verwandeln. Andererseits birgt KI auch das Potenzial, die Medizin menschlicher zu machen. Vor allem wenn sie Verwaltungsaufgaben übernimmt und Ärzten dadurch mehr Zeit für Patienten einräumt.
Stimmen
- Die Studienautoren aus Würzburg und Berlin schlussfolgern: „Wenn Ärzte ihre Patienten über den Einsatz von KI informieren, sollten sie darauf abzielen, potenzielle Bedenken auszuräumen und mögliche Vorteile hervorzuheben. Zum Beispiel könnte der Einsatz von KI für Verwaltungszwecke dazu beitragen, dass Ärzte mehr Zeit für die persönliche Betreuung ihrer Patienten haben.“
- Michael Meier, Professor am Institut für Informatik der Universität Bonn und Leiter der Arbeitsgruppe „IT-Sicherheit“, weist vor allem auf die Risiken bei der Diagnose hin: „Aus Studien zur Cybersicherheit wissen wir, dass vernetzte Medizinprodukte selbst, insbesondere aber die begleitenden Infrastrukturen, Schwachstellen aufweisen, die unbemerkte Manipulationen von Sensordaten ermöglichen können.“
- Karl Max Einhäupl, früherer Vorsitzender des Wissenschaftsrats und Ex-Chef der Charité, entgegnet: „Die Chancen durch KI sind deutlich größer als die Risiken – wenn wir es schaffen, beides in Balance zu bringen. Wir brauchen Datenschutz. Aber allzu umfassenden Datenschutz kann man sich leisten, wenn man gesund ist. Schwerkranke werden sich wünschen, dass es ausreichend viele Daten gibt, aus denen sich die beste Behandlung ableiten lässt.“
Ausblick: Künstliche Intelligenz im Gesundheitssystem
KI wird in den kommenden Jahren tiefer in das Herz der Medizin vordringen – ob man nun will oder nicht. Es stellt sich deshalb nicht die Frage nach dem Ob, sondern wie die Integration von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitssystem gelingt.
Um den Grundstein für eine zuverlässige und sichere Versorgung zu gewährleisten, braucht es eine ausgewogene Balance zwischen Automatisierung und ärztlicher Intuition. Dazu gehören strenge Sicherheitsstandards, ein kontinuierliches KI-Training und klare Verantwortlichkeiten.
Neben der technischen Umsetzung bedarf es zudem Aufklärung der Patienten. Sollte all das gelingen, könnte die Medizin der Zukunft personalisierter sein als je zuvor – vorausgesetzt, es wird verhindert, dass Datenschutz zur Datenwüste und Technikvertrauen zur Technikhörigkeit verkommt.
Eines der größten Heilmittel könnte dann nicht ein neues Medikament oder eine neue Therapie sein, sondern die Kunst Mensch und Maschine zusammenzubringen, damit sie sich ergänzen statt einander ersetzen.
Auch interessant: