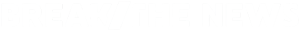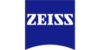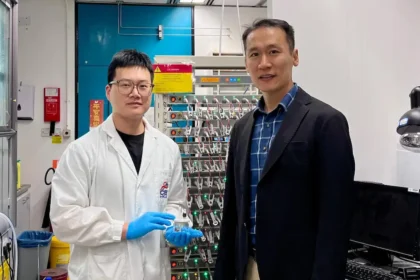In Jülich entsteht derzeit die erste deutsche KI-Fabrik. Herzstück ist der Supercomputer Jupiter, einer der leistungsstärksten und umweltfreundlichsten der Welt. Dem Forschungszentrum in Jülich wird dabei eine Schlüsselrolle beim Aufbau einer europäischen KI-Infrastruktur zuteil. Ziel ist mehr Unabhängigkeit von den USA und China.
Hintergrund: Erste deutsche KI-Fabrik
- Der Supercomputer Jupiter wurde vom Forschungszentrum Jülich entwickelt und befindet sich derzeit in der Testphase. Ende 2025 soll er offiziell in Betrieb gehen. Auf der TOP500-Liste der schnellsten Supercomputer der Welt belegt Jupiter den vierten Platz. Er ist gleichzeitig das energieeffizienteste System unter den Top fünf.
- Die Rechenleistung von Jupiter entspricht der von rund fünf Millionen Notebooks gleichzeitig. Er ist mit 24.000 GH200 Grace Hopper Superchips von NVIDIA bestückt. Sein Einsatzgebiet: Die gleichzeitige Verarbeitung von riesigen Datenmengen und das Training von komplexen KI-Modellen – direkt in Europa und unter EU-Recht.
- Die Jupiter AI Factory ist eine von insgesamt 13 KI-Fabriken, die in Europa entstehen sollen. Fünf davon sollen zu sogenannten Giga-Fabriken ausgebaut werden. Der Standort Jülich gilt als heißer Anwärter. Die Investitionen in die Jupiter KI-Fabrik belaufen sich auf 500 Millionen Euro – verteilt über sechs Jahre sowie finanziert von Bund, vom Land NRW und der EU.
Einordnung: Supercomputer Jupiter in Jülich
Jupiter ist nicht nur einer der leistungsstärksten Supercomputer der Welt, sondern auch ein politisches Versprechen. Er soll Datenmengen bewegen, die bislang nur in den USA oder China verarbeitet werden konnten und Europa eine gewisse digitale Souveränität garantieren.
Doch: Größe und Leistung allein schaffen keinen Nutzen. Jupiter soll zwar Forschung und Industrie gleichermaßen zugutekommen – und es scheint bereits erste Interessenten zu geben. Doch konkrete Anwendungen und Ideen sind bislang eher rar.
Hinzu kommt die Kostenfrage: Denn 500 Millionen Euro sind keine Peanuts, sondern ein Betrag, der sowohl Hoffnungen als auch Skepsis weckt. Energieverbrauch, Betriebskosten und die Frage nach einem langfristigen Nutzen sollten deshalb genau so ernst genommen werden wie die Schlagzeilen über den viertbesten Supercomputer der Welt.
Jupiter hat zweifellos Potenzial und könnte zu einem Magneten für Unternehmen, Start-ups und Forschung werden – vorausgesetzt, er bleibt offen, bezahlbar und praxisorientiert. Doch letztlich braucht Europa mehr als nur Rechenzentren. Es braucht Mut und politische Unterstützung, Projekte und Produkte in den Alltag zu überführen.
Stimmen
- Astrid Lambrecht, Vorstandsvorsitzende des Forschungszentrums Jülich: „Jupiter ist ein zentraler Baustein für Europas digitale Souveränität. Er setzt schon heute neue Maßstäbe, die sein Potenzial für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz demonstrieren.“
- Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen: „Künstliche Intelligenz ist der Rohstoff im digitalen Zeitalter. Der Superrechner Jupiter ist die Turbine, damit wir diesen neuen Rohstoff sinnvoll nutzen können. Ich bin sicher, er wird in Zukunft eine enorme Anziehungskraft für die klügsten Köpfe der Welt entfalten.“
- Auch KI-Experte und Blogger Sebastian Schulze begrüßt die Pläne der EU, weist aber auch auf die Risiken hin: „Es wird auch die Innovationskraft der hiesigen Unternehmen brauchen, die die Infrastruktur nutzen und smarte Anwendungen und Produkte entwickeln. Immerhin scheinen die rechtlichen Hürden in Brüssel erkannt zu sein und das legt die Hoffnung nahe, dass auch hier bald durch den Gesetzgeber eine Wettbewerbsfähigkeit hergestellt werden kann.“
Ausblick: Deutsche KI-Fabrik als Startschuss für Europa
Jupiter ist der Startschuss eines der größten europäischen Experimente. Die geplanten KI-Fabriken rund um die in Jülich sollen ein Netz bilden, das Forschung, Industrie und Gesellschaft gleichermaßen stärkt. Die eigentliche Bewährungsprobe steht jedoch noch aus.
Ob die Jupiter AI Factory ein Ort des Aufbruchs wird oder sich in die Liste gescheiterter europäischer Großprojekte einreiht, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Entscheidend wird sein, wie transparent der Zugang geregelt wird und ob nicht nur Großkonzerne, sondern auch kleinere Akteure mitgestalten dürfen.
Die geplante ökologische Nutzung von Abwärme ist auf den ersten Blick zudem zwar vielversprechend, rentiert sich jedoch nur, wenn das Projekt als Ganzes von Erfolg gekrönt ist.
Letztlich wird vieles davon abhängen, ob es Europa gelingt, neben Rechenzentren auch Anwendungen zu etablieren, die den Menschen spürbar nutzen – beispielsweise in der Medizin oder im Mobilitätssektor.
Auch interessant: