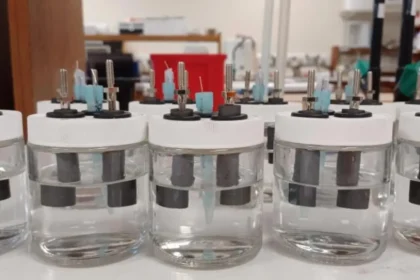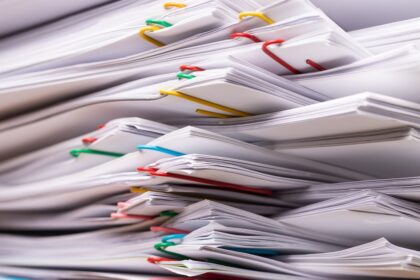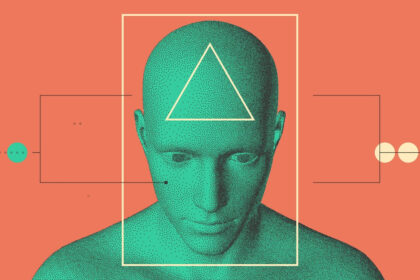Batteriegroßspeicher funktionieren wie ein Parkplatz für Strom. Sie gelten als wichtiger Baustein der Energiewende. Ihr Erfolg hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab.
Batteriegroßspeicher erleben derzeit einen regelrechten Boom. „Parkplätze für Strom“ könnte man die Container-Module auch nennen, die überschüssigen Wind- und Solarstrom sammeln und bei Bedarf ins Netz einsparen.
Einige existieren bereits in Deutschland. So zum Beispiel in Bollingstedt, Schleswig-Holstein. Dort hat Eco Stor 2024 den bisher größten Speicher Deutschlands gebaut. Nun möchte das norwegische Energieunternehmen ein noch größeres Gelände mit den Speichermodulen füllen.
Batteriegroßspeicher: Neuer Parkplatz für Strom soll dreimal so leistungsstark werden
Der Batteriegroßspeicher in Bollingstedt hat eine Leistung von 103,4 Megawatt und eine Kapazität von 238 Megawattstunden. Damit ist die XXL-Batterie in der Lage rund 170.000 Haushalte in zwei Stunden zu versorgen. Das neue Projekt soll eine Leistung von 300 Megawatt haben. Ab 2028 soll es direkt an der A81 in der Nähe von Trossingen entstehen.
Und auch im Rest von Deutschland sprießen immer neue Anlagen aus dem Boden: In Baindt ist außerdem eine 20-Megawatt-Anlage in Planung. In Heiligenberg ging zudem kürzlich eine Großbatterie an den Start, die zehn Megawatt speichert.
EnBW baut unterdessen gemeinsam mit Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW in Marbach einen neuen Batteriespeicher mit 100 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Kapazität, der den Tagesbedarf von rund 12.500 Haushalten abdecken könnte.
Gleichzeitig investiert der Konzern in Phillipsburg in einen Speicher mit 400 Megawatt Leistung und 800 Megawattstunden Kapazität. Das würde theoretisch für 100.000 Haushalte pro Tag ausreichen. Auch im Rest von Deutschland sind weitere XXL-Projekte geplant.
So unterstützen die Energiespeicher die Energiewende
Dass die Strom-Parkplätze derzeit so beliebt sind, hat verschiedene Gründe. Unter anderem geht der Aufschwung auf die gesunkenen Kosten für Lithium-Ionen-Batterien zurück. Mittlerweile sind sie bis zu 75 Prozent günstiger als noch vor zehn Jahren.
Auch politische Anreize heizen den Bau von Batteriegroßspeichern an. Denn wer bis Ende 2028 ans Netz geht, ist für 20 Jahre von Netzentgelten befreit. Außerdem reagieren Batteriespeicher vergleichsweise schnell. Sie gleichen kurzfristige Schwankungen am Stromnetz aus, was mit klassischen Kraftwerken nicht möglich ist.
Einer der größten Vorteile liegt darin, dass die XXL-Batterien helfen können, die Unregelmäßigkeit von Wind- und Sonnenstrom wettzumachen. Sie speichern überschüssigen Wind- und Solarstrom, der dann wiederum zu anderen Zeiten ins Netz eingespeist werden kann.
Damit ermöglichen sie einen höheren Anteil erneuerbarer Energien im Gesamtstromnetz und verringern die Abhängigkeit von fossilen Kraftwerken. Auch ihr ökologischer Fußabdruck ist nach wenigen Monaten amortisiert.
Nachteile von Strom-Parkplätzen
Neben aller Vorteile, gibt es auch bei den Batteriegroßspeichern einige Herausforderungen zu lösen. So bieten sie beispielsweise keine Lösung für sogenannte „Dunkelflauten“, wenn es also gleichzeitig wenig Sonne und Wind gibt. Diese Phasen können über mehrere Tage anhalten und können auch mit Batteriespeichern bisher nicht abgedeckt werden.
Unklare Strategien, wie die Strom-Parkplätze zur Netzstabilität beitragen sollen sowie verzögerte Genehmigungsverfahren stehen dem Anschluss zudem häufig im Weg. Ohne eine zentrale Planung fehlen auch bundesweite Übersichten und Förderprogramme. Auch die Verortung der Anlagen ist noch nicht ausreichend organisiert.
Der Umweltverband BUND sieht Medienberichten zufolge die XXL-Batterien grundsätzlich als große Chance für die zügige Umsetzung der Energiewende. Sie sichern die Versorgung mit erneuerbarem Strom, machen das Netz flexibler und helfen, Emissionen zu senken. Nun braucht es eine klare Strategie, um alle geplanten Projekte umzusetzen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
Auch interessant: