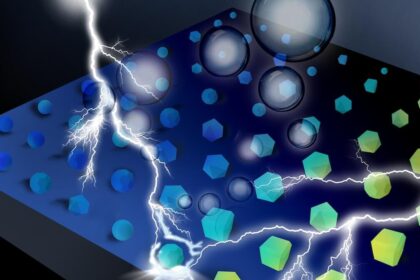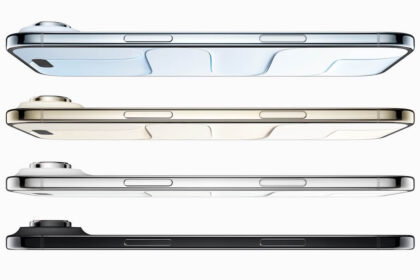Osmosekraftwerke sind vielversprechend für die Energiewende, weil sie eine wetterunabhängige und kontinuierliche Energiequelle darstellen. Japan ist nun in diese Technologie eingestiegen und hat ein erstes Osmosekraftwerk in Betrieb genommen.
Sonnen- und Windkraft gelten als zentrale Pfeiler der Energiewende, sind aber stark von den aktuellen Wetterbedingungen abhängig. Wolken, Windflauten oder jahreszeitliche Schwankungen können die Stromproduktion erheblich beeinflussen.
In windstillen Nächten beispielsweise wird kaum Energie produziert, was die Herausforderungen für die kontinuierliche Stromversorgung sowie die Netzstabilität mit sich bringt. Osmosekraftwerke hingegen sind nicht von diesen Schwankungen betroffen, da sie den Salzgehaltsunterschied zwischen Süß- und Meerwasser nutzen, um Strom zu erzeugen. Dieser Prozess ist unabhängig von Wetter und Tageszeit, weshalb diese Technologie in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte, um wetterbedingte Lücken im erneuerbaren Energiemix zu schließen.
Noch befindet sich die Technologie zur Nutzung der Osmosekraft in einer frühen Entwicklungsphase. Weltweit gibt es nur wenige Pilot- und Demonstrationsanlagen. In Japan ist nun aber ein Osmosekraftwerk ans Netz gegangen, das jährlich rund 880.000 Kilowattstunden Strom produzieren soll.
Osmosekraftwerk geht in Japan ans Netz
Die Fukuoka District Waterworks Agency, also die Wasserbehörde des japanischen Bezirks Fukuoka, ist weltweit erst der zweite Betreiber, der sich der Osmosekraft widmet. Zuvor war bereits 2023 eine Pilotanlage in Dänemark ans Netz gegangen.
Die Wasserbehörde bezeichnet die Technologie als „eine erneuerbare Energiequelle der nächsten Generation“. Neben der Unabhängigkeit von Wetter und Tageszeit wird bei der Stromproduktion außerdem kein Kohlendioxid ausgestoßen, was die Stromproduktion besonders nachhaltig macht.
Bis zu 220 Haushalte soll das Kraftwerk künftig mit Energie versorgen. Laut der Wasserbehörde kann die Anlage jährlich 880.000 Kilowattstunden Strom produzieren.
So funktioniert das Kraftwerk
Ein Osmosekraftwerk nutzt den natürlichen Druckunterschied, der entsteht, wenn Süßwasser und Meerwasser durch eine Membran getrennt werden. Dabei strömt Süßwasser in das Salzwasser, wodurch ein Überdruck entsteht. Dieser Überdruck treibt dann eine Turbine an und kann so Strom erzeugen.
Die Anlage in Fukuoka nutzt jedoch kein Meerwasser, sondern greift auf das „Abwasser“ einer Entsalzungsanlage zurück. Dieses Wasser hat eine viel höhere Salzkonzentration, wodurch eine größere Menge Druck zur Stromproduktion genutzt werden kann.
Auch die Pilotanlage in Dänemark nutzt Abwasser aus dem Salzabbau, da hier der Salzgehalt deutlich höher ist als in herkömmlichem Meerwasser. So kann der Energieertrag von Osmosekraftwerken deutlich erhöht werden.
Denn dieser ist unter normalen Umständen noch nicht optimal. Durch Reibungsverluste an der Membran sowie durch das Pumpen geht bisher noch ein großer Teil der Energie verloren.
Eine Effizienzsteigerung bei den eingesetzten Pumpen sowie bessere Filtermembranen könnten dies jedoch ändern. Osmosekraftwerke könnten so in der Zukunft einen wichtigen Beitrag zum Energiemix aus erneuerbaren Energien leisten.
Auch interessant: