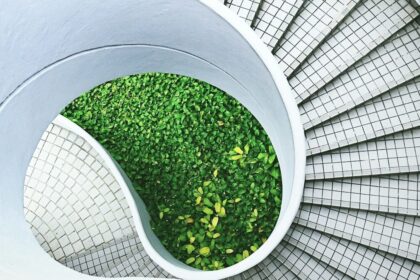Lange Zeit wurde die Musikbranche von den Labels dominiert. Jetzt gibt es einen neuen Gatekeeper am Markt: Spotify. Und das ist nicht gut für jeden.
Nahezu jeder Song ist an nahezu jedem Ort der Welt verfügbar – und das zu einem Bruchteil der frühere Kosten. Und obwohl wir mehr Musik hören als jemals zuvor – der durchschnittliche Spotify-Nutzer beispielsweise streamt mehr als 1.300 Songs im Monat – hat die Musikindustrie seit ihren Hochzeiten Ende der Neunziger 71 Prozent ihrer Umsätze verloren.
Schuld daran sind nicht in erster Linie Piraterie und Raubkopiererei, sondern vor allem die Ökonomie des Streamings. Das jedenfalls meint Brancheninsider Jason Hirschhorn von Redef in einem Special über: „Where the money was, where it went and the possible future.“
Als Steve Jobs die Musikindustrie zum Umdenken zwang
Wo das Geld früher war, ist einfach zu beantworten: bei den großen Labels. Und bei den Künstlern natürlich, die auf den Bestsellerlisten ganz oben standen. Dabei verkauften die Labels lange Zeit ein Produkt, das der Kunde oft gar nicht haben wollte: das ganze Album.
Dieses zwangswirtschaftliche Ungleichgewicht hielten die Labels über Jahre aufrecht. Sie kontrollierten, welche Alben vermarktet wurden. Und sie kontrollierten, welche Alben überhaupt produziert werden sollten.
Die Industrie trat sowohl in Produktion als auch im Vertrieb als Gatekeeper auf und regulierte den Musikmarkt. Bis Steve Jobs den Musikmarkt mit iTunes in ein neues Gleichgewicht zwang. Ein Gleichgewicht, in dem ein Song 99 Cent kostete.
Ein neuer Gatekeeper betritt den Markt
Der Digitalvertrieb beendete die Zwangswirtschaft. Bei Spotify zum Beispiel kann der Nutzer jederzeit und an jedem Ort der Welt auf über 30 Millionen Titel zugreifen. Anstelle der Labels, die die immer gleichen Songs in die knappen Sendeplätze der Radiosender pressten, bestimmen nun die Algorithmen, welche Musik wir hören.
Mehr Auswahl, günstigere Preise, mehr Markt – alles gut? Nun ja, wären da nicht die mikrobischen Vergütungen, die Spotify zahlt. 70 Prozent der Umsätze reicht der Weltmarktführer an die Labels weiter. Welcher Anteil davon einem einzelnen Track zugerechnet werden, das entscheidet sich daran, wie oft ein bestimmter Track im Vergleich zu allen Tracks gehört wurde.
Auf den ersten Blick klingt das sinnvoll. Faktisch ist ein Stream nur noch etwa einen dreiviertel Dollar-Cent wert. Ein Bruchteil der ursprünglichen 99 Cent. Und verschwindend wenig im Vergleich zum Album. Nice Price ist anders.
Der implizite Wert eines gestreamten Songs bei Spotify: etwa ein dreiviertel Dollar-Cent.
Was im Verkauf verloren gegangen ist, das machen Labels und Musiker über Konzerte wieder wett? Nicht ganz. Zwar stiegen die Umsätze mit Konzerttickets in den letzten Jahren. Die großen Labels profitieren hiervon allerdings kaum. Nur etwa ein Drittel der verlorenen Umsätze holen sie „live“ wieder rein.
Entsprechend wenig kommt bei den Künstlern an. „Music is art, and art is important and rare. Important, rare things are valuable. Valuable things should be paid for”, schrieb die Sängerin Taylor Swift 2014 im Wall Street Journal, kurz bevor sie ihren Katalog aus Spotify entfernte. Inzwischen ist sie wieder dabei.
Noch werden 42 Minuten jeder Stunde Musik im Radio gehört. Die zehn Minuten, die Spotify, Pandora und YouTube zusammengenommen in dieser Musikstunde ausmachen, haben gereicht, um aus Kunst eine Massenware zu machen. Und das ist nicht für jeden gut.
Dieser Text stammt aus der Netzwirtschaft – dem Journal für digitale Geschäftsentwicklung. Hier gibt es ein kostenloses Probe-Abo für BASIC thinking-Leser.