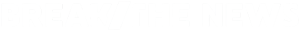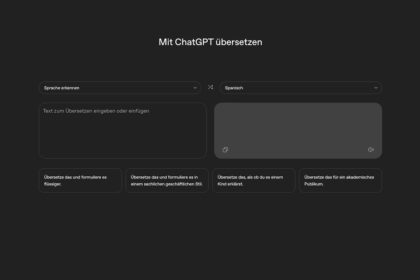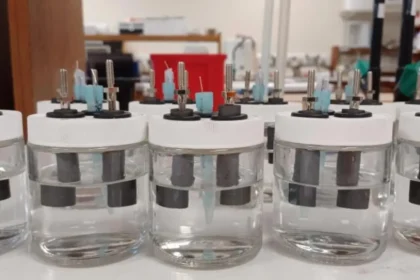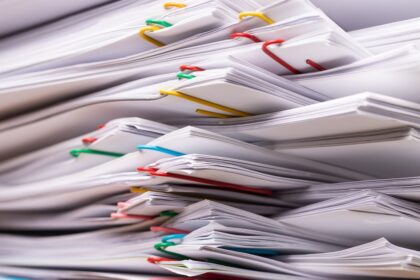Google muss seinen Chrome-Browser nicht verkaufen. Im wohl bedeutendsten Kartellverfahren der Tech-Branche seit Jahrzehnten hat Richter Amit Mehta die Forderung des US-Justizministeriums nach einer Abspaltung von Chrome zurückgewiesen. Stattdessen gibt es mildere Auflagen – und viele offene Fragen für den Wettbewerb.
Hintergrund zum Google-Prozess
- Das US-Justizministerium hatte Google vorgeworfen, seine Marktmacht durch die Kopplung von Chrome und der Suchmaschine zu zementieren. Gefordert wurde die Zerschlagung – konkret: der Verkauf von Chrome, teilweise sogar Android.
- Stattdessen muss Google nun für sechs Jahre Konkurrenten Zugang zu bestimmten Suchindex-Daten und Nutzerkennzahlen gewähren. Außerdem darf der Konzern Smartphone-Hersteller nicht mehr zwingen, Chrome oder andere Google-Apps vorzuinstallieren, um Zugang zum Play Store zu erhalten.
- Die milliardenschweren Deals, mit denen Google seine Suche etwa auf Apple-Geräten als Standard platziert, bleiben jedoch grundsätzlich erlaubt. Lediglich exklusive Verträge sind untersagt.
Unsere Einordnung
Das Urteil lässt Google einerseits aufatmen: Das „Worst-Case-Szenario“ einer Zerschlagung wurde abgewendet. Der Börsenkurs reagierte prompt – im Vergleich zum Vormonat ging es 15 Prozent nach oben. Dennoch ist es ein Pyrrhussieg: Das Gericht bestätigte klar, dass Google ein illegales Monopol im Suchmaschinenmarkt geschaffen und missbraucht hat. Google hat den Prozess also gleichzeitig gewonnen und verloren.
Die nun verhängten Auflagen sind dabei aber vergleichsweise sanft. Google darf seine profitablen Standard-Suchmaschinen-Deals fortführen und Chrome bleibt im Konzern. Die Datenweitergabe an Wettbewerber und gelockerte Bündelungsvorgaben könnten neuen Schwung für kleinere Suchmaschinen wie DuckDuckGo oder Perplexity bringen.
Das Urteil offenbart die Grenzen der US-Kartellaufsicht: Die großen Tech-Konzerne sitzen weiterhin fest im Sattel. Zwar werden neue Leitplanken eingezogen, aber die Frage, wie effektive Regulierung künftig aussehen muss, bleibt offen – nicht nur in den USA, sondern weltweit.
Stimmen zum Google-Chrome-Urteil
- Richter Amit Mehta in seiner Urteilsbegründung: „Die Kläger haben mit der Forderung nach einer erzwungenen Veräußerung dieser wichtigen Vermögenswerte über das Ziel hinausgeschossen.“
- Nidhi Hegde vom American Economic Liberties Project: „Man verurteilt niemanden wegen Bankraubs und lässt ihn dann mit einem Dankesbrief für die Beute davonkommen. Genauso wenig kann man Google für Monopolisierung haftbar machen und dann eine Regel schreiben, die es dem Unternehmen erlaubt, sein Monopol zu schützen.“
- Google selbst ist nicht glücklich mit dem Urteil: “Wir sind besorgt darüber, wie sich diese Anforderungen auf unsere Nutzer und deren Privatsphäre auswirken werden, und prüfen die Entscheidung sorgfältig.”
Ausblick
Für Google ist das Urteil ein Befreiungsschlag – vorerst. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen: Der Konzern will gegen die Monopol-Einstufung Berufung einlegen. Das könnte die Umsetzung der verhängten Maßnahmen um Jahre verzögern.
Für kleinere Suchmaschinen und Browseranbieter bringt das Urteil immerhin etwas Rückenwind. Sie erhalten Zugang zu bislang exklusiven Google-Daten, aber ob das reicht, um Google wirklich zu schwächen, bleibt fraglich.
Die Entscheidung ist ein Signal für künftige Tech-Kartellverfahren – nicht nur in den USA. Auch in Europa und anderen Regionen stehen ähnliche Prozesse an. Die große Frage bleibt: Wie kann Regulierung mit den immer mächtiger werdenden Tech-Konzernen Schritt halten?
Auch interessant: