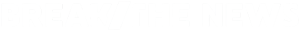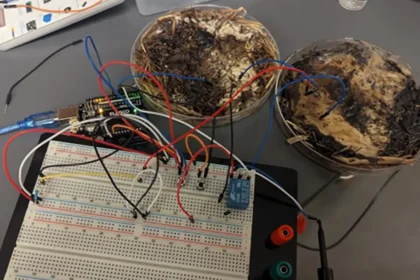Trotz unzähliger Initiativen und geplanter Projekte geht der Ausbau der Meereswindenergie in Europa kaum voran. Neue Offshore-Windparks bleiben zu oft Gedankenspiele der Planer. Ist Windenergie, die auf den europäischen Meeren erzeugt wird, ein Irrweg?
Hintergrund: Meereswindenergie bleibt hinter Erwartungen zurück
- Der europäische Windenergieverband Wind Europe hat sein Herbst-Update 2025 veröffentlicht. Demnach erzeugt Europa 291 Gigawatt an Strom durch Windenergie – 254 auf dem Festland und 37 Gigawatt im Meer. Im ersten Halbjahr 2025 sind nur 6,8 Gigawatt hinzugekommen. Davon entfallen gerade einmal 0,8 Gigawatt auf Offshore-Windparks.
- Dem gegenüber stehen laut Wind Europe 34 Milliarden Euro an sogenannten Financial Investment Decisions (FID). Damit liegen die verbindlichen Projektzusagen schon im ersten Halbjahr 2025 über den gesamten Investitionen im Jahr 2024. Trotzdem entfallen gerade einmal lediglich sechs Projektzusagen auf Meereswindenergie.
- Auch eine Auswertung des britischen Energy Industry Council (EIC) offenbart die Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität mit Blick auf die europäische Windenergie-Strategie. Laut der Branchenorganisation gibt es derzeit Planungen für neue Offshore-Windparks mit einer Kapazität von 411 Gigawatt. Allerdings befindet sich die überwiegende Mehrheit der Projekte noch in der Machbarkeitsphase. Da ist also noch Luft nach oben.
Einordnung: Europa ist energiepolitisch abgehängt
Deutschland und die Europäische Union sind nicht dazu in der Lage, sich selbst mit ausreichend Energie zu versorgen. Wie groß die Abhängigkeit vom Ausland ist, hat nicht zuletzt die Energiekrise nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs in den Jahren 2022 und 2023 offenbart. Damals sind die Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen so schnell in die Höhe geschossen, dass der Staat mit Milliarden aushelfen musste.
Laut dem Statistischen Bundesamt Destatis und Eurostat belief sich der Anteil der Energieimporte in Europa im Jahr 2023 auf insgesamt 58 Prozent. Noch gravierender ist die Abhängigkeit in Deutschland. Hierzulande liegt der Anteil der Nettoenergieimporte bei 66 Prozent. Noch größer ist die Abhängigkeit in Spanien (68 Prozent) und Italien (75 Prozent), während Estland (3 Prozent) und Schweden (26 Prozent) sehr autark von externem Strom sind.
Neben der Kernenergie stellen erneuerbare Energien eine wichtige Stellschraube für die europäischen Länder dar, um mehr energiepolitische Unabhängigkeit zu erreichen. Windenergie auf dem Festland spielt laut Statista dabei mit über 16 Prozent eine wichtige Rolle, während Offshore-Windparks gerade einmal auf einen Anteil von 2,5 Prozent kommen.
Stimmen
- Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zweifelt an der Finanzierbarkeit der Energiewende mit Erneuerbaren Energien und fordert deshalb einen Umstieg auf fossile Brennstoffe. DIHK-Präsident Peter Adrian sagt: „Die Zahlen zeigen: Mit der aktuellen Politik ist die Energiewende nicht zu stemmen. Die Belastung von Unternehmen und Bevölkerung erreicht jedoch ein Niveau, das unseren Wirtschaftsstandort, unseren Wohlstand und damit auch die Akzeptanz der Energiewende gefährdet.“
- Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverband Erneuerbare Energie e.V., sagt zum Vorstoß der DIHK, den Wind- und Solarkraftausbau zu reduzieren und stattdessen wieder verstärkt auf Erdgas zu setzen: „Das Plan B-Szenario aus der DIHK-Studie setzt auf den Import von fossilen Energieträgern und Wasserstoff und bremst gleichzeitig den Ausbau der Erneuerbaren aus. Das würde Deutschland in neue Abhängigkeiten stürzen und das Ziel der Klimaneutralität über Bord werfen. In einer geopolitisch zunehmend unsicheren Lage neue Abhängigkeiten in der Energieversorgung schaffen zu wollen, schwächt die Krisenfestigkeit und Resilienz des Landes erheblich.“
- Die Branchenverbände der deutschen Offshore-Windindustrie suchen in einer gemeinsamen Pressemitteilung die Schuld für den stagnierenden Offshore-Ausbau bei der Politik: „Verzögerungen beim Netzausbau sowie eine gesetzlich festgelegte Flexibilität bei der Fertigstellung von Windparks auf See führen dazu, dass das Ausbauziel in Höhe von 30 GW voraussichtlich 2031 erreicht wird. Die neue Bundesregierung hat alle Möglichkeiten, um die Rahmenbedingungen so zu verstetigen und zu verbessern, dass die Investitionssicherheit gewährleistet ist und gleichzeitig die Klimaziele erreicht werden.“
Ausblick: Klimaschutz versus Naturschutz
Der Ausstieg aus CO2-intensiven Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle ist umweltpolitisch eine Frage der Zeit – eine andere Option gibt es nicht. Deutschland steht dabei vor der Herausforderung, was die beste Alternative zu den fossilen Energieträgern ist. Die Lösung ist ein gesunder Mix aus allen erneuerbaren Energieformen, um sich nicht nur sprichwörtlich auch von Wind und Wetter unanbhängig zu machen.
Das Potenzial von Meereswindenergie ist dabei in Deutschland begrenzt. Selbst das Umweltbundesamt weist in einer Analyse darauf hin, dass die ausschließliche Wirtschaftszone Deutschlands im Vergleich zu anderen Ländern sehr klein ist. Offshore-Windsparks konkurrieren also mit der Schifffahrt, Fischerei, anderen Rohstoffen sowie Forschung und Verteidigung um eine geringe Fläche. Das Wachstumspotenzial für Offshore-Windenergie ist also von Natur aus begrenzt.
Auch interessant: