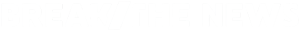Immer mehr Menschen nutzen KI-Tools im privaten oder beruflichen Alltag. Auch im Bildungs- und Gesundheitssystem kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Forscher warnen jedoch vermehrt vor einer Verkümmerung des menschlichen Gehirns. Vor allem Kinder und Schüler scheinen gefährdet.
KI-Nutzung hat messbare Auswirkungen auf das Gehirn
- Forscher des MIT Media Lab haben nachgewiesen, dass die Nutzung von ChatGPT messbare Auswirkungen auf die Gehirnaktivität hat. Die Wissenschaftler sprechen von einer „kognitiven Verzerrung“ als Folge einer häufigen Verwendung von KI-Tools. Gehirnscans würden verminderte Aktivitäten in Bereichen aufweisen, die für komplexe Denkprozesse und die Gedächtnisbildung zuständig sind.
- Laut einer Umfrage der Oxford University gab ein Viertel der 2.000 befragten Schüler an, dass KI das Lernen zu sehr vereinfache. Jeder Zehnte ist zudem der Meinung, dass ChatGPT und Co. die Kreativität einschränken und das kritische Denken verringern. Ein Schüler sagte sogar, dass er nicht mehr ohne KI lernen könne.
- Im Rahmen einer Bitkom-Umfrage gab fast ein Drittel der 14- bis 19-Jährigen an, dass Chatbots ein besserer Hausaufgaben-Helfer sind als ihre Eltern. 23 Prozent empfinden die Antworten von KI-Tools sogar als hilfreicher als die ihrer Lehrkräfte. Die Hemmschwelle „dumme“ Fragen zu stellen sei demnach geringer. Den Ergebnissen zufolge kann KI beim Lernen eine sinnvolle Unterstützung sein.
Wie KI-Tools das Gehirn verkümmern lassen
KI-Tools nehmen ihren Nutzern zunehmend das Denken ab. Zwischen Bequemlichkeit und geistiger Erosion droht aber ein Teufelskreis: Denn je smarter die KI, desto stärker verkümmert das Gehirn – zumindest, wenn man sich dessen nicht bewusst ist.
Ohne kritisches Hinterfragen erspart jede Antwort von ChatGPT und Co. einen Umweg durch das eigene Bewusstsein. Doch genau durch dieses Ringen um Irrtum und Zweifel formt sich echte Intelligenz. Denken darf deshalb nicht zu einer Dienstleistung verkümmern.
KI-Tools sollten aber nicht per se verdammt werden. Denn KI ist kein Virus, sondern bei verantwortungsvoller Nutzung nicht nur hilfreich, sondern auch ein Spiegel für das eigene Bewusstsein. Sie offenbart etwa, wie anfällig der Mensch für Bequemlichkeit ist.
KI kann sowohl Werkzeug als auch Verführer sein. Die Verantwortung sollte jedoch nicht beim Algorithmus liegen, sondern in der Hand, die ihn führt. Denn: Intelligenz braucht Reibung, nicht Schnelligkeit.
Stimmen
- Erika Galea, Direktorin des Educational Neuroscience Hub Europe, warnt: „Die Schüler von heute beginnen, mit Maschinen zu denken – sie gewinnen an Schnelligkeit und Geschicklichkeit bei der Verarbeitung von Ideen, verlieren aber manchmal die Tiefe, die durch Pausen, Hinterfragen und unabhängiges Denken entsteht. Die Herausforderung besteht darin, die Tiefe des menschlichen Denkens in einem Zeitalter der synthetischen Kognition und künstlichen Intelligenz zu bewahren.“
- Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder ist optimistischer: „Richtig eingesetzt kann KI ein wichtiges Werkzeug sein, Schüler individuell beim Lernen zu unterstützen und Lehrkräfte zu entlasten. Die derzeit diskutierten KI-Verbote gehen an den schulischen Realitäten vorbei und lassen sich kaum kontrollieren. Es muss darum gehen, den Einsatz von KI an den Schulen zu trainieren und das Verständnis für die Funktionsweise von KI zu verbessern.“
- Psychologe und Hirnforscher Peter Gerjets vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen: „Es darf nicht passieren im Bildungsprozess, dass der aktive Lernprozess an ChatGPT ausgelagert und das Gehirn nicht gefordert wird. Es ist wichtig, was im Kopf passiert und was als echte Lernleistung herauskommt. Ob das mit oder ohne Unterstützung von GPT passiert, ist letztlich nicht entscheidend.“
KI gefährdet kritisches Denken
KI-Tools bergen die Gefahr, die Gesellschaft zu verrohen. Denn wenn die Antworten von ChatGPT und Co. nicht hinterfragt werden, bleibt die Wahrheit auf der Strecke – KI-Halluzinationen lassen grüßen.
Zwischen digitalem Doping und geistiger Disziplin entsteht dabei ein neues Bildungsökosystem, das mehr verlangt als Technikkompetenz: nämlich ein Bewusstsein und speziell angepasst KI-Tools.
Die Evolution des Geistes verläuft aber nicht linear, weshalb Künstliche Intelligenz bei klugem Einsatz, sogar ein neuer Katalysator für menschliche Reflexion werden könnte – auch im Bildungssystem. Doch damit kritisches Denken nicht verdunstet wie in den sozialen Medien und Schlagzeilen statt Inhalte konsumiert werden, ist Aufklärung essenziell.
Andernfalls droht Bequemlichkeit zur Abhängigkeit zu werden. Wenn Bildung, Wissenschaft und Politik das Zusammenspiel von Mensch und Maschine bewusst gestalten, könnte die KI-Ära aber ein Befreiungsschlag sein und das Denken vertiefen, anstatt es weiter zu zerstören.
Auch interessant: