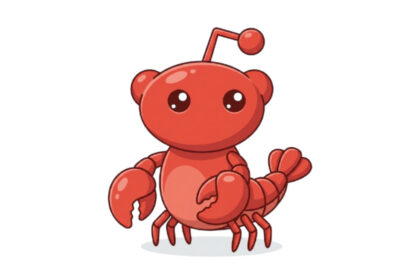In Bayern wurde kürzlich eine neue schwimmende Solaranlage eingeweiht. Die Besonderheit: Die Photovoltaik-Module sind vertikal angeordnet. Durch die neue Technologie sei das 1,87-Megawatt-Projekt sturmfest, leistungsstark und stabilisiere das Ökosystem.
Solarenergie spielt eine wichtige Rolle im deutschen Energiemix. Der Anteil an der gesamten Stromproduktion lag 2024 bei einem neuen Höchstwert von fast 14 Prozent.
Zur Eingrenzung des Flächenbedarfs an Land gibt es bereits einige Photovoltaik-Anlagen auf dem Wasser. In Deutschland eignen sich vor allem geflutete Tagebauflächen, Kiesgruben und Stauseen. Laut Fraunhofer-Institut bergen sie ein technisches Potenzial von 44 Gigawatt-Peak.
Die erste schwimmende Solaranlage mit vertikalen Modulen
Um dieses Potenzial noch effizienter zu nutzen, hat das deutsche Cleantech-Unternehmen Sinn Power eine neue Technologie namens „SKipp Float“ entwickelt. Auf ihr basiert eine neue PV-Anlage, die Anfang Oktober 2025 auf einem Baggersee bei Gilching in Betrieb genommen wurde.
Im Gegensatz zu herkömmlichen schwimmenden Konstruktionen basiert das System auf senkrecht montierten Modulen, die in Ost-West-Ausrichtung installiert und durch mindestens vier Meter breite Freiwasserkorridore getrennt sind.
Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei dem neuen Projekt um die erste vertikal schwimmende Photovoltaikanlage der Welt. Sie soll neue Maßstäbe in der nachhaltigen Stromerzeugung auf Binnengewässern setzen.
Schwimmende PV-Anlage soll zwei Gigawatt-Stunden Strom im Jahr liefern
Mit einer installierten Leistung von 1,87 Megawatt, einer erwarteten Jahresstromproduktion von rund zwei Gigawatt-Stunden und einer Bedeckung der Seefläche von nur 4,65 Prozent habe die Anlage eine bislang unerreichte spezifische Leistungsdichte.
Da die Anlage mit ihrem Flächenbedarf unter der im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgelegten Obergrenze von 15 Prozent liegt, ist bereits eine zweite Ausbaustufe mit zusätzlichen 1,7 Megawatt in Planung.
Im Laufe des Jahres sollen 2.600 PV-Module den Netzstrombedarf des Kieswerks der Jais GmbH am Gilchinger See voraussichtlich um bis zu 70 Prozent senken. Nicht verbrauchter Strom soll in Zukunft ins Netz eingespeist werden. Allerdings wurde bisher noch kein Speichersystem installiert.
Schwimmende Solaranlage Sturm- und Wellenfest
Eine kielartige Unterstruktur mit bis zu 1,60 Meter Tiefe fixiert die Module in vertikaler Position an einem schwimmenden Kabelsystem, das mit einem zentralen Einspeisepunkt am Ufer elektrisch verschaltet ist. Es erlaubt der Anlage kontrollierte Bewegungen bei Winddruck.
So werden mechanische Belastungen minimiert und die Stabilität bei wechselnden Wasserständen gewährleistet. Gleichzeitig sorgt das für Festigkeit bei Sturm und Wellen.
Die Konfiguration der schwimmenden Solaranlage sorgt laut Hersteller außerdem für eine gleichmäßige Stromproduktion über den gesamten Tagesverlauf hinweg und erhöht die spezifischen Erträge.
Die Leistungsspitzen und Produktionsüberschüsse würden vor allem in den Morgen- und Abendstunden entstehen, wenn die Einspeisevergütung an den Strombörsen am höchsten ist.
Ökologisch verträgliche PV-Anlage
Neben der energetischen Effizienz überzeuge die schwimmende Solaranlage auch ökologisch. Die Konstruktion lasse Sauerstoffaustausch und Sonnenlicht an der Wasseroberfläche zu und fördere zusätzlich die natürliche Umwälzung der Wasserschichten.
Erste Beobachtungen hätten gezeigt, dass die Anlage selbst neuen Lebensraum schafft: Auf den Schwimmkörpern des Seilsystems wurden brütende Wasservögel gesichtet, im Bereich der kielartigen Rückstellgewichte sammeln sich Fischschwärme.
Messbojen, die bereits vor Baubeginn installiert wurden, zeigen, dass sich die Wasserqualität seit der Inbetriebnahme tendenziell verbessert hat. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Anlage keine Beeinträchtigung des Ökosystems verursacht, sondern lokal eher stabilisierende Effekte hat.
Der Spatenstich für die schwimmende Solaranlage erfolgte bereits im November 2024. Die Einweihung im Oktober 2025 fand im Beisein zahlreicher wirtschaftlicher und politischer Akteure statt, unter anderem dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Seiner Ansicht nach verbinde das Projekt „ökonomische Wertschöpfung mit internationalem Interesse“.
Auch interessant: