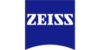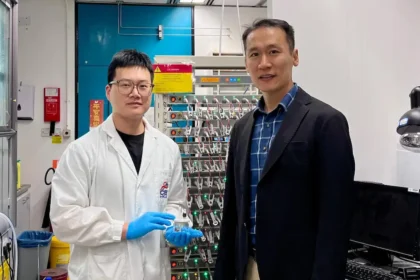Neue Erkenntnisse der Universität Tokio zeigen das Potenzial von Mikrowellen im Kampf gegen Treibhausgase. Sie könnten dabei helfen, CO2 effizient in Treibstoff umzuwandeln.
Viele chemische Produktionsprozesse in der Industrie basieren auf Wärme. Mit herkömmlichen Heizmethoden wird jedoch oft Energie verschwendet, da große Bereiche erwärmt werden, die es eigentlich nicht benötigt. Wissenschaftler der University of Tokyo haben deshalb eine Methode entwickelt, die Wärme nur dort bündelt, wo sie gebraucht wird.
Der Ansatz basiert auf Mikrowellen, ähnlich denen in einer Haushaltsmikrowelle, um spezifische Elemente in den Zielmaterialien zu erhitzen. Die Forscher konzentrierten die Mikrowellenenergie dazu selektiv auf einzelne atomare Stellen.
Dadurch können komplizierte chemische Reaktionen deutlich effizienter ablaufen. Das System konnte etwa eine 4,5-fach höhere Energieeffizienz erreichen als herkömmliche Techniken. Das übergeordnete Ziel ist die „grüne Transformation“ in der industriellen Chemie, wobei primär die Verringerung des Energiebedarfs und der Emissionen eine zentrale Rolle spielen.
CO2 in Treibstoff umwandeln: Neue Methode verspricht nachhaltigen Ansatz
Normalerweise treten chemische Reaktionen lediglich an winzigen, lokalisierten Regionen auf, die nur wenige Atome oder Moleküle umfassen. Herkömmliche Heizmethoden, wie Verbrennung oder heiße Flüssigkeiten, verteilen die thermische Energie jedoch großflächig.
Die Forscher nutzten deshalb Mikrowellen, um Energie auf eine einzelne atomar aktive Stelle zu konzentrieren, vergleichbar mit der Funktionsweise einer Mikrowelle, die Speisen erhitzt. Mit dieser selektiven Wärmezufuhr und bestimmten Materialien können auch bei niedrigeren Gesamttemperaturen sehr anspruchsvolle Reaktionen erreicht werden.
Dazu gehören die Wasserspaltung oder die Methankonvertierung, die beide für die Herstellung von Brennstoffen nützlich sind. Ein wichtiger Vorteil der Technik ist die Möglichkeit zur Kohlenstoffabscheidung und -wiederverwertung, indem CO2 im Rahmen der Methankonvertierung recycelt wird.
In diesem Fall könnte das System zur Reduzierung von Kohlenstoffdioxid beitragen, indem das Treibhausgas in andere nützliche Chemikalien umgewandelt wird.
Skalierung noch schwierig
Für die Experimente stimmten die Forscher ihre Mikrowellen auf etwa 900 Megahertz ab. Diese relativ niedrige Frequenz erwies sich als optimal für die Erhitzung des untersuchten Materials Zeolith. Das ist eine poröse Substanz, die Wärme effizient aufnehmen und übertragen kann.
Im Inneren der schwammartigen Zeolith-Hohlräume agieren Indium-Ionen wie Antennen. Diese werden durch die Mikrowellen in Schwingung versetzt und erzeugen Wärme, die dann auf die durchfließenden Reaktionsmaterialien übertragen wird.
Die größte Herausforderung ist derzeit die Hochskalierung der Technologie, um sie für die industrielle Nutzung attraktiv zu machen. Denn was im Labor funktioniert, lässt sich oft nicht leicht auf große Industrieanlagen übertragen. Die Materialanforderungen sind komplex, und die Herstellung des Katalysators ist weder einfach noch kostengünstig.
Zudem ist es kompliziert, Temperaturen auf atomarer Ebene präzise zu messen, weshalb die aktuellen Daten auf indirekten Beweisen beruhen. Derzeit sind die Forscher auf der Suche nach Unternehmenspartnern, um die Technologie weiterzuentwickeln. Pilotversuche werden innerhalb des nächsten Jahrzehnts erwartet.
Auch interessant: